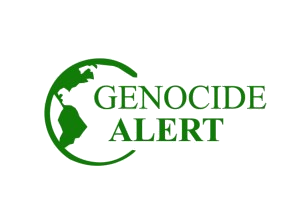Libyen: Die Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft
Seit Tagen lässt der libysche Staatschef Muammar Gaddafi auf demonstrierende Zivilisten schießen. Die Zahl der Toten soll in die Tausende gehen, und doch tut sich die internationale Gemeinschaft schwer, konkrete Maßnahmen zu beschließen. Dabei ist sie dazu verpflichtet.
Im Wüstenstaat Libyen herrscht seit dem 15. Januar, als in Benghasi die ersten Proteste ausbrachen, der Ausnahmezustand. Nach dem Vorbild Tunesiens und Ägyptens will sich nun das libysche Volk vom Joch des Tyrannen Muammar Gaddafi befreien. Doch der exentrische Machthaber Libyens, der sich selbst als ewiger Revolutionsführer bezeichnet, denkt nicht daran, es den tunesischen und ägyptischen Diktatoren gleich zu tun, und schon bald von der Bildfläche zu verschwinden. Stattdessen wiegelt er seine Anhänger zur Gewalt auf und lässt sein Volk von ausländischen Söldnern und der Luftwaffe beschießen. Zeugen vor Ort sprechen von tausenden Toten, wie Saif al-Islam Gaddafi versprochen hatte, fließt das Blut in Strömen. Immer mehr Diplomaten Libyens sagen sich von ihrem Führer los. Und doch regt sich auf der Ebene der internationalen Gemeinschaft nicht viel.
Seit Tagen tun sich die internationalen Institutionen schwer damit, auf die Tragödie in Libyen zu reagieren. Erst zehn Tage nach Anfang der Proteste konnten die südlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union davon überzeugt werden, dass Europa mit Sanktionen reagieren muss. Die Nato bietet an, gegebenenfalls eine Flugverbotszone über Libyen durchzusetzen, die Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung unterbinden würde. Doch diese Maßnahmen erfordern ein UN-Mandat, und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen fällt es besonders schwer, sich zu mehr als einer Verurteilung der Gewaltakte durchzuringen. Dabei ist er eigentlich zu mehr verplichtet.
Im Jahre 2005 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig das Prinzip der Schutzverantwortung angenommen. Sie soll vor allem dazu beitragen, dass Verbrechen wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen rechtzeitig von UNO-Mitgliedsstaaten, der UNO selbst, regionalen und subregionalen Organisationen sowie zivilgesellschaftlichen Akteuren erkannt und verhindert werden. Falls eine Regierung unfähig oder unwillens ist, ihre eigene Bevölkerung zu beschützen, oder sie selbst Verbrechen ihr gegenüber verübt, wie dies in Libyen momentan der Fall ist, dann wird die Schutzverantwortung auf die internationale Gemeinschaft übertragen. Sie muss in diesem Fall dafür Sorge tragen, dass die von Massakern bedrohte Bevölkerung geschützt wird, wobei Zwangsmittel wie Sanktionen oder sogar eine militärische Intervention nicht ausgeschlossen sind.
Der Kern des Konzepts der Schutzverantwortung ist allerdings die sogenannte „Responsibility to Prevent“. Sie umfasst, neben einer generell auf Armutsbekämpfung und Streitschlichtung ausgerichteter Außenpolitik, ein Frühwarnsystem, dass potentielle Konflikte herausheben soll, bevor sie ausbrechen. Leider hat die internationale Gemeinschaft in diesem Gebiet kläglich versagt. Seit zwei Monaten wüten Unruhen durch die arabische Welt, und doch scheint die internationale Gemeinschaft bei jedem neuen Fall ungläubig daneben zu stehen und nach Worten zu ringen.
Die Schutzverantwortung bedeutet vor allem, in Situationen von zwingender Notwendigkeit zum Schutz der Menschen zu reagieren. Wenn präventive Maßnahmen zur Behebung der Situation fehlschlagen, dann sind umfassendere Interventionsmaßnahmen erforderlich. Waffenembargos, das Ende von militärischen Kooperationen, das Einfrieren von Bankkonten, die Einrichtung von Flugverbotszonen, eine Einschränkung der Reisefreiheit für Mitglieder des Regimes und das Ruhen der Mitgliedschaft oder ein Ausschluss aus internationalen oder regionalen Organisationen sind Teil der Schutzverantwortung. Auch wird sich Gaddafi vor dem Internationalen Strafgerichtshof für potenzielle Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten müssen. Doch muss man sich im Falle Libyens fragen, inwiefern sich Gaddafi davon beeindrucken lässt und die Gewalt gegen sein Volk einstellt. Schließlich war Gaddafi schon früher jahrzehntelang der Paria der Staatengemeinschaft, als er den internationalen Terrorismus unterstützte.
Die Rückkehr Libyens in die internationale Gemeinschaft lässt sich auch nur im Kontext der veränderten Verhältnisse nach dem 11. September 2001 und der Invasion des Iraks durch die Amerikaner erklären. Gaddafi hatte schlicht Angst, wie Saddam Hussein zu enden. Deshalb gab er sein Atomprogramm auf und dann lieferten sich die westlichen Staaten ein Wettrennen, wer die besten Deals mit Libyen abschloss. Das Kurzzeitgedächtnis der westlichen Staaten wurde in den letzten Tagen gewaltsam wieder aufgefrischt. In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass sich die internationale Gemeinschaft bald ihrer Pflicht, nämlich das libysche Volk vor ihrem Diktator zu retten, erinnert. Denn abzuwarten und am Ende die Toten zu zählen, wäre mehr als unverantwortlich. Es wäre ein Verbrechen.