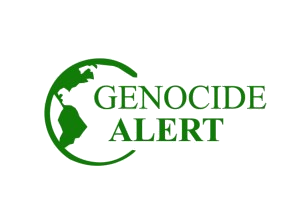Die Friedensgespräche zwischen der sudanesischen Regierung und einer Rebellengruppe aus Darfur haben in Doha, Qatar zur Unterzeichnung einer Absichtserklärung für einen Friedensprozess geführt. Die politischen und operativen Hürden sind jedoch so groß, dass die Friedensbekundungen der Beteiligten als Lippenbekenntnissen bezeichnet werden müssen. Wenn der Friedensprozess in Gang kommen soll, muss die internationale Gemeinschaft und insbesondere auch die Europäischen Union kritische Unterstützung leisten und gezielten Druck ausüben.
Am 17. Februar, nach einer Woche Verhandlungen in der Qatarischen Hauptstadt Doha, haben die Vertreter des Justice and Equality Movement (JEM) und der sudanesischen Regierung eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das Dokument drückt den Willen der Parteien aus, den Darfur Konflikt mit ‘vereinten Kräften’ friedlich zu lösen und dabei einen umfassenden Ansatz zu wählen, welcher auch die zugrundeliegenden Konfliktursachen berücksichtigen würde.
Um gegenseitiges Vertrauen zu bilden und ein positives Klima für die geplanten Friedensverhandlungen zu schaffen, haben beide Seiten Zugeständnisse gemacht und beschlossen die Zivilbevölkerung Darfurs zu beschützen, den Zugang von humanitärer Hilfe zu erleichtern sowie Gefangene auszutauschen.
Am 4. März hatten drei Richter des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) einem Haftantrag gegen den sudanesisch Präsidenten Bashir wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen stattgegeben. In dessen Folge hatte die sudanesische Regierung 13 humanitäre Hilfsorganisationen des Landes verwiesen und damit vertrauensbildende Kerngehalte der Absichtserklärung verletzt. Dennoch haben sich beide Parteien zur Weiterführung der Friedensgespräche bereit erklärt. Das JEM hatte jedoch angedroht seine Position zu überdenken, würde die sudanesische Regierung nicht mit dem IStGH kooperieren und Al-Bashir nach Den Haag ausliefern.
Seit dem Beginn des Darfurkonflikts im Jahre 2003 gab es eine Serie von Waffenstillstandsvereinbarungen, Erklärungen zur Beendigung von Feindseligkeiten und Bekenntnisse zur friedlichen Konfliktlösung. Keine Initiative war bislang vom Erfolg gekrönt.
Die Gründe für die fehlgeschlagenen Friedensbemühungen sind seit Jahren dieselben und müssen auf politischer wie auch auf operativer Ebene gesucht werden.
Politische Ebene
Auf politischer Ebene gibt es verschieden Faktoren, warum die erneuten Friedensgespräche als halbherzig betitelt werden müssen und wenig Aussicht auf Erfolg haben. Die Friedensgespräche zwischen den JEM Rebellen und der sudanesischen Regierung waren alles andere als umfassend, da zwei weitere wichtige Rebellen Gruppen nicht teilnahmen und auch die weitere darfurische Zivilgesellschaft nicht repräsentiert wurde. Die beiden Gesprächsparteien versäumten es ausserdem, klare Verhandlungsziele zu formulieren. Es wäre angebracht gewesen, eine Einstellung der bewaffneten Auseinandersetzungen zu vereinbaren und die Grundlage für ein stabiles Waffenstillstandsabkommen zu schaffen. In diesem Sinne muss die gemeinsame Absichtserklärung als ein zwar begrüßenswertes, jedoch insgesamt mageres Resultat bezeichnet werden.
In der Theorie ist klar, welche Elemente für einen erfolgreichen Friedensprozess berücksichtigt werden müssen. Die meisten Analysten betonen die Wichtigkeit von umfassenden Friedensgesprächen, an denen alle relevanten Konfliktparteien ohne Vorbedingungen teilnehmen. Des Weiteren betonen Darfur Experten drei Faktoren, welche zentral für die Stabilität und Glaubwürdigkeit eines Friedensabkommens sind: (1) Stop bewaffneter Konfrontationen und die Schaffung minimaler Sicherheit durch gegenseitige Sicherheitsgarantien und deren Überwachung durch Friedenstruppen; (2) die Lösung von Landrechtsstreitigkeiten und die Etablierung eines fairen Landrechtssystems; (3) Reparationsleistungen des Staates zur Entschädigung der Opfer.
Sudan-Experte David Reeves vertritt die Meinung, dass die derzeitigen Friedensgespräche nur deshalb soweit gediehen seien, weil die Mitglieder der Arabischen Liga und das JEM momentan überlappende Interessen hätten. Die JEM profitiert von diesen bilateralen Gesprächen, indem es sich als einziger Gesprächspartner unter den Darfur-Rebellengruppen etabliert und seiner politischen Agenda Gehör verschafft. Verschiedene Mitgliedstaaten der Arabischen Liga verfolgen ihre eigenen Interessen und unterstützen das Regime in Khartum, ohne sich um die Bedürfnisse der nicht-arabischen Bevölkerung Darfurs zu kümmern. Während Qatar sich als Vermittler hervortun möchte, ist Ägypten vor allem an der Stabilität und territorialen Integrität des Sudans interessiert. Auch Libyen und Saudi Arabien haben bisher eine wenig konstruktive Rolle gespielt. Die sudanesische Regierung selbst sieht die Friedensgespräche als ein Mittel, der internationalen Gemeinschaft ihren guten Willen zu beweisen. Mit den Gesprächen riskiert das Regime jedoch wenig, da nur eine Rebellengruppe daran teilnimmt und die zahlreichen anderen Rebellengruppen Darfurs so sehr gespalten sind, dass ein Friedensprozess mit Machtteilungsmechanismen in weiter Ferne liegt.
Angesichts des Haftbefehls gegen den sudanesischen Präsidenten Bashir dient die Gesprächsbereitschaft vor allem dazu, den Sicherheitsrat von einem Haftaufschub gemäss Artikel 16 des Romstatuts zu überzeugen. Dem Sicherheitsrat soll eine Entscheidung zwischen Frieden und Gerechtigkeit aufgezwungen werden. Das Regime in Khartum möchte der internationalen Gemeinschaft glauben machen, dass die strafrechtliche Verfolgung Bashirs Friedensgespräche untergraben und zu zusätzlichen gewalttätigen Unruhen in Darfur führen könnte. Im Gegenteil dazu würde ein Haftaufschub die Verbesserung der katastrophalen humanitären Situation erlauben und es ermöglichen, die laufenden Friedensgespräche erfolgreich fortzuführen.
Dieser Argumentation können jedoch die Erfahrungen der letzten 20 Jahre entgegen gehalten werden. In dieser Zeit hat die Regierungspartei – National Islamic Front (NIF), heute NCP – nicht eine einzige Vereinbarung mit anderen innerstaatlichen Konfliktparteien eingehalten. Ein Beispiel der jüngsten Vergangenheit war der einseitig erklärte Darfur Waffenstillstand der Regierung vom 12. November 2008, welcher innerhalb von 24 Stunden mit Luftangriffen auf zivile Ziele gebrochen wurde. Dass es die Regierung diesmal ernster meint, ist deshalb zu bezweifeln. Das Justice and Equality Movement seinerseits hat seine alleinige Teilname an den Gesprächen sowohl seiner militärischen Stärke als auch der ablehnenden Haltung einer weiteren Rebellengruppe – Sudan Liberation Army, SLA – zu verdanken. Diese exklusive Verhandlungsposition ist ganz im Sinne der JEM, welche sich als alleinige legitime Oppositionsgruppe im Darfur zu etablieren versucht.
Die genannten politischen Gründe sind große Hürden auf dem Weg zu einem umfassenden und aufrichtigen Friedensprozess. Sie machen schon den ersten Schritt eines Waffenstillstandsabkommens zu einer schwierigen Aufgabe. Dieser notwendige erste Schritt wird durch operative und technische Hindernisse noch zusätzlich erschwert.
Operative Ebene
Die Friedensgespräche in Doha lassen weltweit Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand aufkeimen. In einem kürzlich erschienen Artikel nennt Sudan-Experte Alex de Waal jedoch verschiedene operative und technische Gründe, aus denen ein Waffenstillstandsabkommen nicht in unmittelbarer Reichweite liegt und schwierig umzusetzen ist.
Erstens, erfordert ein effektives Waffenstillstandsabkommen die Beteilung aller relevanten Konflitkparteien. Bislang wurden aber, wie oben beschrieben, verschiedene Gruppen nicht berücksichtigt, während andere es vorziehen weiter zu kämpfen.
Zweitens, gehen die meisten Verhandlungsführer fälschlicherweise davon aus, dass ein Waffenstillstand oder eine Einstellung der Feindseligkeiten rasch und einfach ausgehandelt werden könne. Aus operativen Gründen ist dies jedoch nicht möglich. Ein Waffenstillstandsabkommen ist ein komplexes militärisches Unterfangen, das umfassende Vorbereitungen und ein entsprechendes Training erfordert. Die militärischen Entscheidungsträger aller Konfliktparteien müssen in den Regeln und Verfahren eines Waffenstillstandes ausgebildet und für verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten eines solchen Waffenstillstandes sensibilisiert werden. Diese Ausbildung muss vor den Waffenstillstandsverhandlungen stattfinden und dauert gemäss Expertenschätzungen mindestens sechs Monate. Dazu kommen noch einmal mindestens drei Monate für die eigentlichen Verhandlungen. Einen Waffenstillstand auszuhandeln und erfolgreich zu implementieren ist demnach ein langwieriges Unterfangen, welches gut vorbereitet werden muss.
Drittens, ist es entscheidend, die Kombattanten während eines Waffenstillstandes zu versorgen. In einer komplexen Konfliktsituation wie der in Darfur versorgen sich insbesondere die Rebellengruppen durch konfliktnahe Aktivitäten wie Handelssteuern, Diebstahl und andere kriminelle Aktivitäten sowie Überfälle auf gegnerische Truppen und deren Infrastruktur. Es ist deshalb wichtig, die Konfliktparteien logistisch und materiell zu unterstützen. Die Anreize müssen so gesetzt werden, dass die Konfliktparteien in ihrem Entscheid bestätigt und ihnen die Einhaltung des Abkommens materiell ermöglicht wird. Ein weiteres Hindernis für einen stabilen Waffenstillstand im Darfur zeigt sich in der Natur des Konflikts und den Eigenschaften der Rebellengruppen. Eine erfolgreiche Aushandlung und Implementierung eines Waffenstillstandes erfordert die Identifikation von Truppenstandorten und die Zuteilung von Zuständigkeitsgebieten. Diese Vorgehensweise ist nur sehr schwierig auf die JEM Rebellen anzuwenden, da diese mit ihren ‚Technicals‘ hoch mobil sind und ihre Operationsbasis nicht an einen bestimmten Territorium festmachen, wie dies konventionelle Streitkräfte tun.
Als letzter Grund ist die Komplexität des Konflikts an sich zu nennen. Der Darfur Konflikt besteht aus mehreren überlappenden Konflikten, welche eine Vielzahl an Akteuren und Interessen beinhalten und es so äußerst schwierig machen, das Ausmaß der Gewalt zu reduzieren und bewaffnete Auseinandersetzungen zu überwachen. Wenn das Ausmaß der Gewalt nicht ausreichend reduziert werden und Gewaltausbrüche nicht eindeutig identifiziert und analysiert werden können, ist es unmöglich, das nötige Vertrauen zwischen den Konfliktparteien zu schaffen und einen stabilen Waffenstillstand zu erreichen. Dazu braucht es eine effektive Friedenstruppe. Jedoch ist die hybride AU/UN Friedensmission aus Mangel an Personal und Material (noch immer) nicht in der Lage, diese Aufgaben zu erfüllen.
Schlussfolgerungen
Wenn die Friedensgespräche in Doha zu einem stabilen Waffenstillstand führen und in einen erfolgreichen Friedensprozess münden sollen, müssen die politischen Hindernisse reduziert und die operativen Hürden aus dem Weg geräumt werden. Dies ist kein Ding der Unmöglichkeit, erfordert jedoch das aufrichtige Engagement der Konfliktparteien, der Staaten der Arabischen Liga, der Afrikanischen Union und vor allem die zusätzliche Unterstützung und den gezielten Druck durch die internationale Gemeinschaft. Die folgenden Empfehlungen könnnen den Weg zu einem potenziellen Friedensprozess weisen:
Der Sicherheitsrat muss den Sondergesandten der UN und der Afrikanischen Union, Bassolé, in dessen Verhandlungsbemühungen uneingeschränkte unterstützen.
Die Europäische Union muss die Staaten der Arabischen Liga, die Afrikanische Union und die Konfliktparteien zu aufrichtigen Friedensverhandlungen aufrufen. Sie muss ausserdem einen umfassenden Friedensprozess fordern, welcher zusätzliche Konfliktparteien mit einbezieht und die Konfliktursachen berücksichtigt.
Der Sicherheitsrat sollte zu diesem Zeitpunkt keinen Haftaufschub gemäß Artikel 16 des Romstatuts beschließen, da dies weder Frieden noch Gerechtigkeit bringen und lediglich die Strategie der sudanesischen Regierung bestätigen würde.
Der Friedensprozess und die erfolgreiche Aushandlung eines Waffenstillstandes erfordert die Unterstützung einer glaubwürdigen und einflussreichen Drittpartei. Diese Rolle könnte von der EU übernommen werden. Die EU muss hierbei auf einen umfassenden und integrativen Ansatz drängen. Sie sollte notwendige langfristige Vorbereitungen treffen und sich nicht zu raschen Resultaten gedrängt fühlen. Sie muss vor allem auch die notwendige Ausbildung und Versorgung der Konfliktparteien garantieren.
Die internationale Gemeinschaft muss ausserdem die Darfur-Friedenstruppe UNAMID stärken, damit diese in eine Lage versetzt wird, den Schutz der Zivilbevölkerung in Darfur sowie die Einhaltung eines zukünftigen Waffenstillstandes garantieren zu können.
Christoph Bleiker, Policy Analyst Genocide Alert