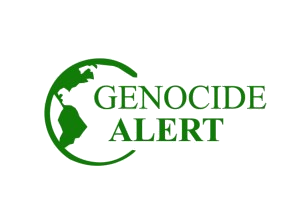Lehren aus dem Völkermord in Ruanda – Genocide Alert in der Diskussion mit Politik und Wissenschaft
Der Völkermord in Ruanda im Jahr 1994 ist ein düsteres Kapitel der Menschheitsgeschichte. In nur etwa 100 Tagen wurden zwischen April und Juli 1994 ungefähr 800.000 Menschen getötet. Radikale Angehörige der Hutu-Mehrheitsbevölkerung gingen gegen die Tutsi-Minderheit, oppositionelle Hutu und andere Minderheiten vor und setzten einen im Voraus vorbereiteten Völkermord in die Tat um. Die internationale Gemeinschaft sah zu und ordnete die Situation falsch ein. Obwohl im Land stationierte UN-Blauhelme bereits Monate zuvor vor den Vorbereitungen auf einen Völkermord gewarnt hatten, entschieden sich die im UN-Sicherheitsrat vertretenen Großmächte dagegen einzugreifen bzw. die UN-Mission in Ruanda zu stärken. Was hat die internationale Gemeinschaft, was hat Deutschland aus diesem schrecklichen Ereignis gelernt? Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um solche Gräueltaten in Zukunft zu verhindern?
Diese und andere Fragen waren Thema einer Online-Diskussionsveranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung am 18. März 2024. Unter dem Titel „Lehren aus dem Völkermord in Ruanda: Zur Notwendigkeit von Mechanismen zur Prävention von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ diskutierte die Moderatorin Andrea Böhm, Journalistin bei der Wochenzeitung DIE ZEIT mit Dr. Anton Peez vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung , Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt und Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen sowie dem Vorsitzenden von Genocide Alert, Dr. Gregor Hofmann. Philipp Rothmann vom Global Public Policy Institute schloss die Runde mit einem Resümee.
Gefahr eines Völkermords hätte 1994 erkannt werden können
In der Diskussion wurde nochmals deutlich: Die internationale Gemeinschaft und auch die deutsche Diplomatie unterschätzten damals die ethnische Dimension des Konflikts in Ruanda. Die Gefahr eines Völkermords hätte anhand der aufhetzenden Medienberichterstattung im Land und den von unterschiedlichen Akteuren – auch deutschen Diplomat:innen, Militärs und Entwicklungshelfenden – beobachteten Vorbereitungen für eine Gewalttat gegen die Tutsi erkannt werden können.
So warnte nicht zuletzt Romeo Dallaire, Kommandeur der UN-Mission UNAMIR, die zur Beobachtung eines 1993 vereinbarten Waffenstillstands im Land war, im Januar 1994 eindringlich vor den Vorbereitungen für den Völkermord: Die Hutu-Regierungspartei erstelle schwarze Listen mit Angehörigen der Tutsi-Minderheit und Oppositionellen. Staatlich unterstützte Milizen horteten massenhaft Waffen, und radikale Elemente innerhalb der Regierung planten einen Genozid im Land – so Dallaire in einem Fax an das UN-Hauptquartier am 11. Januar 1994.
Doch eine frühzeitige Reaktion auf die sich zuspitzende Lage in Ruanda blieb aus, hob Gregor Hofmann in der Diskussion hervor: Eine Bereitschaft zum Eingreifen bestand nicht, weder bei den Vereinten Nationen, noch bei anderen Akteuren. Das damals noch junge Konzept der Friedenserzwingung mit UN-Mandat war in Kritik geraten: 1993 waren im Rahmen der humanitären Intervention in Somalia 18 US-Soldaten getötet worden, Ihre Leichen wurden geschändet, die Bilder medial weltweit verbreitet. Daher seien die USA nicht bereit gewesen, sich 1994 in einen weiteren Krieg in Afrika einzumischen. Frankreich war unterdessen mit der ruandischen Regierung eng verbandelt. Auch die deutsche Bundesregierung handelte nicht.
Erst im Sommer 1994 konnte das Morden in Ruanda beendet werden. Entscheidend war jedoch nicht eine dann mit UN-Mandat intervenierende französische Mission. Vielmehr beendete die einstige Bürgerkriegspartei, die oppositionelle, aus Tutsi bestehende Ruandische Patriotische Front, den Genozid, nachdem sie weite Teile Ruandas unter ihre Kontrolle gebracht hatte.
Studie: Deutschland hat Warnzeichen in Ruanda übersehen
Das Nicht-Handeln zeichnen auch Anton Peez und Sarah Brockmeier in ihrer 2021 erschienenen Studie „Akteneinsichten“ nach, die bei der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht wurde und nun im Vorfeld des 30. Jahrestages des Völkermords in Ruanda auch auf Englisch erschienen ist. Die Studie basiert auf bislang geheimen Akten des Auswärtigen Amtes, die die beiden Autor:innen schon vor Ablauf der 30-jährigen Sperrfrist einsehen konnten, und ergänzenden Interviews.
Die Ergebnisse stellte Anton Peez im Rahmen der Diskussion am 18. März 2024 kurz vor. So habe die deutsche Botschaft in Kigali 1993 und 1994 klare Warnzeichen übersehen oder nicht an die Zentrale des Auswärtigen Amtes in Bonn weitergeleitet. Zwar habe niemand, auch nicht die deutschen Mitarbeitenden in der Entwicklungszusammenarbeit in Ruanda, die letztendliche Intensität und das Ausmaß der Gewalt erahnt. Gleichwohl habe aber die deutsche Botschaft die problematische Sicherheitslage gar heruntergespielt – obwohl sie zumindest grundsätzlich darüber im Bilde war, dass die Gefahr organisierter Gewalt entlang ethnischer Linien in Ruanda möglich sei. Die Zentrale des Auswärtigen Amtes in Bonn ignorierte unterdessen schon im Jahr 1993 Warnungen von Menschenrechtsorganisationen vor gezielter Verfolgung von Tutsi.
Aus ihrer Studie leiten Sarah Brockmeier und Anton Peez diverse Empfehlungen für die deutsche Politik ab, darunter u.a. gezielte Fortbildungsmöglichkeiten für Diplomat:innen und Mitarbeitende anderer Ressorts zu Risikofaktoren für Völkermorde und andere schwerste Menschenrechtsverletzungen, bevor diese in potenziell kritische Regionen entsandt werden. Auch Berichtspflichten für relevante Beobachtungen vor Ort an die jeweiligen Zentralen in Deutschland, eine bessere Koordination zwischen den Bundesministerien in Fällen möglicher Massenverbrechen und mehr Planstellen im Auswärtigen Amt für Analyse und Strategieentwicklung in der Krisenreaktion mahnen die beiden Forschenden in ihrer Studie an.
Responsibility to Protect als Lehre aus Ruanda?
In der Diskussion wurden auch Lehren der internationalen Gemeinschaft aus dem Völkermord in Ruanda 1994 und anderen Fällen gravierender Massenverbrechen erörtert. In Deutschland ist das Konzept der zivilen Krisenprävention in den Jahren der Rot-Grünen Bundesregierung ausbuchstabiert worden – auch in Reaktion auf Ruanda und den Völkermord in Srebrenica 1995.
International wurde Anfang der 2000er Jahre das Konzept der internationalen Schutzverantwortung (Responsibility to Protect, R2P) entwickelt, so Gregor Hofmann. Auf dem UN-Weltgipfel 2005 bekannten sich alle Staaten zur Verantwortung, ihre eigene Bevölkerung vor Massenverbrechen zu schützen. Außerdem vereinbarten sie, sich gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu unterstützen und im Extremfall, bei Völkermorden und anderen Massenverbrechen, durch den UN-Sicherheitsrat einzugreifen. In der Praxis fehle es jedoch in konkreten Fällen oftmals am Willen und politischer Einigkeit, so Gregor Hofmann. Der UN-Sicherheitsrat bleibe häufig im Angesicht von Massenverbrechen blockiert. Syrien, Myanmar, Ukraine oder auch Äthiopien sind Beispiele der jüngeren Vergangenheit, in denen der Sicherheitsrat nicht in der Lage war, angemessen zu reagieren.
Was passierte 1994 in Ruanda?
Wie erlebten die Menschen vor Ort die Geschehnisse? Wie reagierte die internationale Gemeinschaft (nicht)? Welche Beziehung hatte Deutschland zu Ruanda? Wie versäumte es Deutschland den Genozid zu stoppen? Und wie konnte es zu diesen Ereignissen kommen? Mit all diesen Fragen werden wir uns in den nächsten 100 Tagen beschäftigen. Folgt uns auf Instagram, um nichts zu verpassen.
>> Zum Projekt „100 Tage Zusehen“
Responsibility to Protect als Lehre aus Ruanda?
In der Diskussion wurden auch Lehren der internationalen Gemeinschaft aus dem Völkermord in Ruanda 1994 und anderen Fällen gravierender Massenverbrechen erörtert. In Deutschland ist das Konzept der zivilen Krisenprävention in den Jahren der Rot-Grünen Bundesregierung ausbuchstabiert worden – auch in Reaktion auf Ruanda und den Völkermord in Srebrenica 1995.
International wurde Anfang der 2000er Jahre das Konzept der internationalen Schutzverantwortung (Responsibility to Protect, R2P) entwickelt, so Gregor Hofmann. Auf dem UN-Weltgipfel 2005 bekannten sich alle Staaten zur Verantwortung, ihre eigene Bevölkerung vor Massenverbrechen zu schützen. Außerdem vereinbarten sie, sich gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu unterstützen und im Extremfall, bei Völkermorden und anderen Massenverbrechen, durch den UN-Sicherheitsrat einzugreifen. In der Praxis fehle es jedoch in konkreten Fällen oftmals am Willen und politischer Einigkeit, so Gregor Hofmann. Der UN-Sicherheitsrat bleibe häufig im Angesicht von Massenverbrechen blockiert. Syrien, Myanmar, Ukraine oder auch Äthiopien sind Beispiele der jüngeren Vergangenheit, in denen der Sicherheitsrat nicht in der Lage war, angemessen zu reagieren.
Angesichts von Doppelstandards und im Lichte der umstrittenen Umsetzung der R2P im Bürgerkrieg in Libyen 2011 stehen zudem viele Staaten des Globalen Südens dem Konzept kritisch gegenüber. Die Umsetzung der Responsibility to Protect konzentriert sich überwiegend auf den Präventionsaspekt. Konzeptionell legten dies die Berichte des UN-Generalsekretärs dar. Das UN Office for the Prevention of Genocide and the Responsibility to Protect habe zudem einen Frühwarn-Analyserahmen entwickelt, der helfen könne, kritische Situationen zu identifizieren.
www.schutzverantwortung.de
Unser Informationsportal Schutzverantwortung.de informiert über das Konzept der Schutzverantwortung, über dessen Ursprünge und Ausgestaltung.
>> http://www.schutzverantwortung.de
Bedeutung von Tribunalen und Internationalem Strafgerichtshof nicht unterschätzen
Auch juristische Instanzen, wie der Internationale Strafgerichtshof und internationale Tribunale spielten eine wichtige Rolle für die Prävention von Völkermord, so Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Man dürfe nicht unterschätzen, wie wichtig es sei, dass mit den Tribunalen zu Ruanda und Jugoslawien und dem Internationalen Strafgerichtshof – trotz aller Probleme der Gerichtshöfe – ein Weg beschritten worden sei, hin zur Festigung von Freiheit und innerem Frieden durch Recht. So zeige z.B. auch der Krieg in der Ukraine, dass sich die Dinge verändert hätten in dieser Hinsicht. Heute würden der Internationale Strafgerichtshof und andere Strafverfolgungsbehörden bereits während des Konflikts Beweise für eine spätere Strafverfolgung sammeln.
In Deutschland würde zudem die Generalbundesanwaltschaft auf Grundlage des Völkerstrafgesetzbuches zu einer Verfolgung von Massenverbrechen beitragen. Erste Täter aus Syrien sind so durch die deutsche Justiz bereits angeklagt worden. Sicher könne dies militärische und andere Mittel im Angesicht akuter Gewalt nicht ersetzen. Doch für eine langfristige Lösung, für nachhaltigen Frieden sei der Zugang zum Recht für die Opfer unerlässlich, so Katja Keul. Ihr sei dabei jedoch bewusst, dass im Angesicht anhaltender Gewalt manche Strafverfolgung wie Hohn für die Opfer wirke. Ein Beispiel sei die Anklage von Omar al Bashir, ehemaligem Diktator in Sudan, bezüglich der Massenverbrechen in Darfur, die seinerzeit keine Auswirkung auf die Situation der Menschen vor Ort hatte.
Info-Portal Internationale Strafgerichtsbarkeit
Bereits vor dem IStGH gab es verschiedene Ad-Hoc Gerichtshöfe und Kriegsverbrechertribunale. Diese haben entscheidend zur Entwicklung des Völkerstrafrechts beigetragen, indem sie Verantwortliche für Kriegsverbrechen und Völkermorde einer rechtmäßigen Bestrafung zugeführt haben.
>> Zum Projekt „Internationale Strafgerichtsbarkeit: Ad-hoc Tribunale im Vergleich“
Massenverbrechen im Sudan: Binden Abhängigkeiten Deutschland die Hände?
Mit dem Stichwort Darfur wandte sich die Diskussion am 18. März dann auch aktuellen Konflikten zu. Deutschland habe, so hob etwa Gregor Hofmann hervor, in den Leitlinien „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ das Verhindern von Völkermord und schwersten Menschenrechtsverletzungen zur deutschen Staatsraison erklärt. Doch sei bis heute unklar, wie genau das umgesetzt werden könne. Militärische Gewalt ist oft keine Möglichkeit – mangels Kapazitäten, aber auch mangels Chancen auf Erfolg. Oftmals muss versucht werden, über dritte Parteien Druck auf die Täter:innen oder die Konfliktparteien auszuüben, um akut anhaltende Massenverbrechen einzudämmen.
Andrea Böhm verwies in der Diskussion zunächst auf den Bürgerkrieg in Sudan, wo der Konflikt zwischen Armee und der RSF-Miliz (Rapid Support Forces) das Land in eine humanitäre Krise gestürzt habe. In Darfur werden dabei immer wieder Warnungen vor einem Völkermord laut, begangen durch Angehörige der RSF. Katja Keul verwies dabei auf die intensiven Bemühungen der internationalen Gemeinschaft und auch Deutschlands, alle involvierten externen Mächte zu einer Lösung des Konflikts zu bewegen, zuletzt z.B. im Rahmen der internationalen humanitären Konferenz für den Sudan und seine Nachbarländer am 15. März in Paris.
Andrea Böhm betonte daraufhin, dass in Sudan unterschiedliche externe Mächte an den Seiten unterschiedlicher Konfliktparteien stünden. So hielten die Vereinigten Arabischen Emirate die RSF mit Waffen und Geld am Leben, während Ägypten die sudanesische Armee unterstütze. Deutschland und die EU seien zugleich auf die Zusammenarbeit mit diesen Staaten angewiesen, z.B. hinsichtlich der Versorgung mit Gas. Die EU habe zudem ein Migrationsabkommen mit Ägypten geschlossen und sich zum Schutz der Außengrenzen in eine Abhängigkeit begeben. Binde sich Deutschland damit nicht die Hände im Hinblick auf die Verhinderung von Völkermorden?
Welche Priorität hat die Prävention von Völkermord als deutsche Staatsräson?
Katja Keul verwies darauf, dass die Bundesrepublik diese Unterstützung durchaus bewusst sei und dass hinter verschlossenen Türen deutlich stärkerer diplomatischer Druck auf diese Länder aufgebaut werde, zu einer konstruktiven Lösung der Situation in Sudan beizutragen.
Gregor Hofmann warf einen warnenden Blick in die Vergangenheit: So habe sich die Bundesrepublik angesichts des massiven Eingreifens Russlands in Syrien ab 2015 zugunsten des Assad-Regimes mit Kritik zurückgehalten, trotz direkter russischer Beteiligung an Kriegsverbrechen. Man habe damals negative Auswirkungen auf andere geopolitische Bereiche, insbesondere den Ukraine-Konflikt gefürchtet. Die Eskalation dort sei dann trotzdem gekommen.
Die Bundesregierung müsse offen aussprechen, welche Priorität sie dem Bekenntnis zur Prävention von Völkermord als deutsche Staatsräson zumesse. In Bezug auf Sudan und die Unterstützung der Konfliktparteien durch die Golfstaaten und Ägypten bedeutet das trotz der Abhängigkeitsverhältnisse mehr Druck auf letztere aufzubauen, damit diese ihren Einfluss auf die Konfliktparteien geltend zu machen und das Töten beenden. Wollen wir mit Staaten kooperieren, die Völkermorde zumindest fahrlässig unterstützen?
Ruandas unrühmliche Rolle heute im Ost-Kongo
Zum Schluss wandte sich die Diskussion einem weiteren Krisenherd zu: Dem Ostkongo. Dort spiele Ruanda heute eine unrühmliche Rolle, so Andrea Böhm. Niemand könne ernsthaft abstreiten, dass die M23-Rebellen, die für schwerste Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, durch Ruanda ausgerüstet und finanziert würden.
Katja Keul antwortete darauf, sie sei zutiefst beunruhigt angesichts der Situation im Kongo. Dass auf die abziehende UN-Mission MINUSCO eine offensivere Mission der Southern African Development Community (SADC) folge, entspreche der Erkenntnis, dass Regionalorganisationen aufgrund besserer Kenntnis lokaler Kontexte oftmals besser geeignet seien, in komplexen Situationen zu intervenieren.
Deutschland und die EU hätten erst im März in einer Erklärung Ruanda mitadressiert, zu einer Lösung beizutragen. Es handele sich schließlich nicht um einen reinen Konflikt zwischen Milizen, sondern de facto um eine Art zwischenstaatlichen Konflikt. Zur Lösung müssten entsprechende regionale Formate gefunden werden.
Erneute Warnungen vor einem möglichen Völkermord an Tutsi
Bzgl. der Situation im Ostkongo, so fragte Andrea Böhm abschließend, müssten doch für eine Organisation wie Genocide Alert die Alarmglocken läuten. Nicht nur wegen des Verhaltens Ruandas, sondern auch angesichts der kongolesischen Propaganda, die voller Hassrede gegen Tutsi sei.
Gregor Hofmann stimmte zu, die Situation eskaliere. Er verwies dabei auch darauf, dass die Gewalt der aus der Tutsi-Minderheit rekrutierenden M23 dazu beitrage, dass sich eine genozidäre Stimmung gegenüber den Tutsi im Ostkongo entwickele, insbesondere durch lokale Milizen. Es sei zu hoffen, dass mit der auf die abziehende UN-Mission folgende SADC-Mission effizient Schutz von Zivilisten stattfinde und ein politischer Prozess zur Lösung des Konflikts eingeleitet werde.
Prävention muss noch mehr Realität werden
Mit diesem Blick auf die heutige Situation im Umfeld Ruandas in Ostafrika endete die Diskussionsrunde. In einem abschließenden Grußwort verwies Philipp Rothmann vom Global Public Policy Institute darauf, dass die Ukraine und Sudan vielleicht sinnbildlich dafürstünden, wo noch Handlungsbedarf in der deutschen Außenpolitik bestehe.
Zwar sei man heute weiter, wenn es um Frühwarnung gehe. Im Hinblick auf präventives Handeln müsse man sich den hehren Werten jedoch noch stärker in der Realität verschreiben. Anregungen hierfür finden sich nicht zuletzt in der Studie von Anton Peez und Sarah Brockmeier zur deutschen Rolle während des Völkermords 1994.
Podiumsdiskussionen, Interviews und Essaywettbewerb in Gedenken an den Völkermord in Ruanda
20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda führte Genocide Alert im Jahr 2014 Podiumsdiskussionen, Interviews und einen Essaywettbewerb durch, um an den Völkermord in Ruanda 1994 zu erinnern und daraus zu ziehende Lehren für die gegenwärtige Politik zu debattieren.
>> Zur Projektseite „20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda: Was haben wir gelernt?“