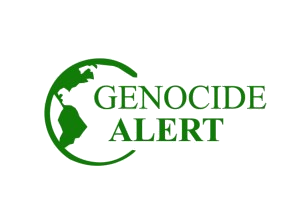„20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda“
Projektseite zum Genocide Alert Ruandaprojekt
„20 Jahre danach – Was sind die Lehren aus dem Völkermord in Ruanda?„
Wie können zivilgesellschaftliche Organisationen zur Verhinderung von Völkermord beitragen?

Podiumsdiskussion am 15.05.2014 in Mainz
Als die US-amerikanische Kongressabgeordnete Patricia Schroeder vor 20 Jahren von Journalisten gefragt wurde, warum sich die USA nicht engagierter für ein Ende des Mordens in Ruanda einsetzten, antwortete sie Ende April 1994 ehrlich: Sie habe hunderte Anrufe von Wählern erhalten, die sich um die Gorillas in Ruanda sorgten. Nur selten hätte sich jemand nach den Menschen erkundigt. Es bestand für amerikanische Politiker schlichtweg wenig öffentlicher Druck mehr zu tun, um das Morden zu beenden. Mit dieser Anekdote eröffnete die Moderatorin und stellvertretende Vorsitzende von Genocide Alert, Sarah Brockmeier, die Podiumsdiskussion am 15. Mai 2014 zum Thema „20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda: Welche Rolle spielen NGOs und die Zivilgesellschaft bei der Verhinderung von Völkermord?“. Im Wappensaal im Landtag Rheinland-Pfalz diskutierten Annonciata Haberer, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Rwandische Diaspora in Deutschland e.V.“, Ulrike von Pilar, Mitbegründerin von Ärzte ohne Grenzen (MSF) in Deutschland, Rudolf Fischer, von 1993 bis 1998 Leiter des Partnerschaftshauses für die Länderpartnerschaft Rheinland-Pfalz und Ruanda in Kigali, und Michael Nieden, heutiger Leiter der Geschäftsstelle des Vereins Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda e.V..
Auszug aus dem Ergebnisbericht
„Was uns aber am meisten erschreckte, war die völlige Vergiftung des menschlichen Zusammenlebens.“
– Rudolf Fischer, 1993 Leiter des Partnerschaftshauses von Rheinland-Pfalz in Ruanda
Im ersten Teil der Diskussion blickten die ReferentInnen zurück auf die Zeit während des Völkermords in Ruanda 1994 und diskutierten, wie der Völkermord in Deutschland wahrgenommen wurde und wie die Partnerschaft Rheinland-Pfalz-Ruanda mit den Ereignissen umging. Insbesondere drei Antworten zu diesen Fragen wurden in der Diskussion deutlich.
➤ 1. Schon vor dem Völkermord waren auch für die Vertreter der Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda Warnzeichen wahrnehmbar.
Rudolf Fischer, der vor Oktober 1990 und ab Herbst 1993 als Leiter des Partnerschaftshauses von Rheinland-Pfalz in Ruanda arbeitete, erzählte von den Spannungen in Ruanda, die in den frühen neunziger Jahren schon sehr präsent waren. Die wirtschaftliche Lage war bedrohlich und gleichzeitig fand seit Oktober 1990 ein Bürgerkrieg statt. Im Norden und Süden des Landes wohnten tausende von Menschen in Flüchtlingslagern. „Was uns aber am meisten erschreckte war die völlige Vergiftung des menschlichen Zusammenlebens“, so erinnerte sich Fischer. „Man hatte einen Sündenbock gefunden. Die Saat des Rassenhasses war wirklich aufgegangen. Es gab Gewalt geradezu überall.“ Die Missionare und Projektleiter, die das Partnerschaftshaus besuchten, berichteten davon, dass überall im Land Milizen mit Waffen ausgestattet worden waren. Im Süden des Landes nahm Fischer einen neuen Gruß wahr: „Jagt die Kakerlaken!“ Überall sei die Angst spürbar gewesen.
„Was uns aber am meisten erschreckte, war die völlige Vergiftung des menschlichen Zusammenlebens.“
– Rudolf Fischer, 1993 Leiter des Partnerschaftshauses von Rheinland-Pfalz in Ruanda
➤ 2. Während des Völkermords war die Medienberichterstattung in Deutschland zwar schlecht, aber es bestand die Möglichkeit von Deutschland aus die Situation in Ruanda zu verfolgen.
Frau Haberer lebte 1994 in Deutschland. Der Völkermord kam mit einer Wucht, mit der sie nicht gerechnet hatte. Sie habe von Deutschland aus über Fernsehen, Radio und Zeitungen die Ereignisse in Ruanda verfolgt. Viel moralische Unterstützung habe sie aus Rheinland-Pfalz erhalten. Man habe sich gegenseitig besucht, Informationen ausgetauscht, Zeitungsmeldungen analysiert. Durch die Medien und gemeinsame Freunde habe man dann Informationen erhalten, wer gestorben sei. „Das nennt man: Verlust von Heimat“, so erinnerte sich Frau Haberer: „Es gab so viele Freunde und Bekannte, die ermordet wurden.“
Rudolf Fischer erinnerte sich an ein sehr großes Interesse an den Ereignissen in Ruanda in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel in den regionalen Zeitungen. Es habe ein hohes Interesse der Bevölkerung, auch in den Schulen gegeben. „Grundsätzlich war es so, dass es sehr viele Informationen gab.“ Wie jedoch eine Teilnehmerin im Publikum betonte, war die Berichterstattung in Deutschland insgesamt „medioker“. Die Medien hätten den Völkermord immer nur als „Stammeskrieg“ dargestellt. Die mediale Aufmerksamkeit sei schließlich erst mit den Flüchtlingsbewegungen in Richtung Kongo gestiegen.
„Das nennt man: Verlust von Heimat – Es gab so viele Freunde und Bekannte, die ermordet wurden.“
– Annonciata Haberer, stellvertretende Vorsitzende von „Rwandische Diaspora in Deutschland e.V.“
Herr Nieden betonte, dass die allgemeine Bevölkerung in Rheinland-Pfalz sich wie der Rest der deutschen Bevölkerung angesichts der Nachrichten aus Ruanda eher ohnmächtig fühlte. Man habe wie bei allen Konflikten in Afrika eher gedacht: „die hauen sich da wieder die Köpfe ein.“ Die Menschen, die mit der Partnerschaft und mit Ruanda mehr zu tun gehabt hätten, seien alle geschockt gewesen. Es habe allerdings Unterschiede gegeben zwischen den Gruppen in der Partnerschaft, die vorher im Norden Ruandas gearbeitet hätten, und denen, die vorher im Süden aktiv waren. Die Gruppen, die eher im Norden zu tun hatten, hätten den Völkermord anders wahrgenommen: Im Norden lebten fast keine Tutsi und dort war der Angriff der Tutsi-Rebellen und der Bürgerkrieg sehr präsent – diese Gruppe sah den Völkermord eher durch diese Perspektive des Bürgerkriegs. Ein zweiter Schock sei für alle gekommen als man lernte, wer zu den Tätern und zu den Opfern gehörte.
Auf der Ebene der Landespolitik habe man, was die deutsche Politik während des Völkermords anging, nicht viel ausrichten können, so Nieden. Die Landesregierung hätte der Bundesregierung Informationen weitergeleitet und Nachfragen gestellt, aber sie sei nun mal nicht für die Außenpolitik zuständig. Auch mit seiner Anfrage, 147 Pfadfinder als Flüchtlinge aufzunehmen, sei der damalige rheinland-pfälzische Innenminister an der Innenministerkonferenz gescheitert.
➤ 3. Es gab humanitäre Organisationen, wie Ärzte ohne Grenzen (MSF), vor Ort, die mehr Engagement der internationalen Gemeinschaft gefordert haben.
Ulrike von Pilar berichtete von der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen (MSF) während des Völkermords. Sie erzählte von einem Tag in Butare Ende April, an dem 120 Patienten und Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen ermordet wurden. Ein Kollege hatte ihr von diesem Tag berichtet:
„Alle Mitarbeiter und Patienten wurden in den Hof des Krankenhauses aufgereiht und in Hutu und Tutsi eingeteilt. Es war klar, was das bedeutete. Die Kollegen waren schockstarr und überlegten krampfhaft, was man tun könne. Aber wir sind, wie sie wissen, immer unbewaffnet und man konnte wenig tun. In dem Moment wird eine Mitarbeiterin namens Sabine auf die Tutsi-Seite geführt und mein Kollege beschreibt wie er interveniert und sagt, ‚nein, nein, Sabine nicht, Sabine, das weiß ich, ist Hutu.’ Und einer der Milizionäre zieht eine Liste aus der Tasche und guckt sich die Namen an und sagt: ‚Ja, Doktor, sie haben Recht, Sabine ist Hutu. Aber sie ist schwanger und das Baby wird Tutsi. Und beide müssen sterben.’ Mehr Beweis brauchte es nicht um klar zu sehen, dass es sich tatsächlich um Völkermord handelte.“
„Mit Ärzten stoppt man keinen Völkermord.“
– Ulrike von Pilar, Ärzte ohne Grenzen (MSF)
Ärzte ohne Grenzen bezeichnete die Ereignisse in Ruanda daraufhin Ende April 1994 als einen Völkermord. MSF Frankreich forderte zudem explizit eine internationale militärische Intervention, um den Völkermord aufzuhalten – eine sehr außergewöhnliche und umstrittene Forderung für eine humanitäre Hilfsorganisation. Ulrike von Pilar schilderte einige der Diskussionen, die in ihrer Organisation dazu stattfanden. Letztendlich war die Situation vor Ort so schwierig, dass man explizit gesagt habe: „Mit Ärzten stoppt man keinen Völkermord“. Zivilgesellschaftliche Organisationen könnten grundsätzlich keinen physischen Schutz ersetzen – das sei damals auch vielen in der deutschen Öffentlichkeit nicht klar genug gewesen. Humanitäre Hilfe brauche ein Minimum an Respekt für die Genfer Konventionen und das allgemein anerkannte Grundeinverständnis, dass Zivilisten ein Recht auf humanitäre Hilfe haben. „In einem Völkermord ist genau dieses Grundeinverständnis zerstört. Genau die Menschen, die wir schützen sollten, waren das Ziel der Gewalt. Deswegen sind wir zum Schluss gekommen an die Öffentlichkeit zu gehen und haben sogar eine Militärintervention gefordert.“
Teil 2: Wo stehen wir heute im Bezug auf zivilgesellschaftliches Interesse bei der Verhinderung von Völkermord?
Im zweiten Teil der Veranstaltung diskutierten die Podiumsteilnehmer und das Publikum, was seit dem Völkermord in Ruanda gelernt wurde und wie es zu mehr zivilgesellschaftlichen Engagement bezüglich der Verhinderung von Völkermord kommen könnte. Insgesamt, so betonten es auch Ulrike von Pilar und Michael Nieden in der Diskussion, sei das öffentliche Interesse für komplexe Konflikte heute nicht größer als vor 20 Jahren. Sie nannten den Konflikt in der Zentralafrikanische Republik als Beispiel. Einig waren sich die ReferentInnen außerdem darin, dass man zivilgesellschaftliche Organisationen nicht mit Verantwortung überfrachten dürfe: Bei der Bewertung, was NGOs, aber auch normale Bürger leisten könnten, sei Bescheidenheit geboten.
Dennoch fragte Frau von Pilar hinsichtlich des Engagements in der deutschen Bevölkerung zur Verhinderung schwerster Menschenrechtsverbrechen: „Wo sind die Parteien? Die Kirchen? Warum ruft niemand zu Demonstrationen in Berlin auf? Für die Flüchtlinge in Syrien, gegen das Morden in der Zentralafrikanischen Republik? Wo sind die alle?“ Auch Herr Nieden fragte direkt die Jugendlichen im Publikum: „Wenn ihr jetzt Gewalt in der Welt seht, zum Beispiel in Nigeria, der Zentralafrikanische Republik, Syrien. Wie nehmt ihr das wahr? Wie nehmt ihr die Medien war? In euren Schulen, wird das diskutiert? Wird das virtuell diskutiert? Fühlt ihr euch da überrollt?“
„Wo sind die Parteien? Die Kirchen? Warum ruft niemand zu Demonstrationen in Berlin auf: Für die Flüchtlinge in Syrien, gegen das Morden in der Zentralafrikanischen Republik? Wo sind die alle?“
– Ulrike von Pilar, Ärzte ohne Grenzen (MSF)
Insgesamt gab es mindestens vier konkrete Vorschläge, wie es zu mehr zivilgesellschaftlichen Engagement zur Verhinderung von Völkermord und Konflikten kommen könnte:
➤ 1. Die Herstellung von persönlichen Bezügen führt zu mehr Interesse und Engagement.
Ein entscheidender Faktor für das Engagement der meisten Menschen, so betonten es viele der Diskussionsteilnehmer, sei der persönliche Bezug zum Land oder zu einer Konfliktsituation. „Wenn man keinen Menschen dort persönlich kennt, geht man auch nicht für die Menschen dort protestieren“, so fasste es Frau Haberer zusammen. „Damals, 1994, konnte jeder in der ganzen Welt sehen, was in Ruanda passierte. Aber es war viel zu viel für die meisten Leute. Sie wollten wegschauen.“ Dies habe für Ruanda gegolten und gelte heute immer noch für Syrien oder den Südsudan. Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz damals sei durch die Partnerschaft sensibilisiert gewesen für die Ereignisse in Ruanda. Der Völkermord sei auch in Schulen besprochen worden. „Aber nur die Leute, die mit Ruanda zu tun hatten, waren wütend über die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft.“
„Damals, 1994, konnte jeder in der ganzen Welt sehen, was in Ruanda passierte. Aber es war viel zu viel für die meisten Leute. Sie wollten wegschauen.“
– Annonciata Haberer, stellvertretende Vorsitzende von “Rwandische Diaspora in Deutschland e.V.”
Eine Länderpartnerschaft, wie die zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda, wurde auch gleich mehrmals als ein Beispiel genannt, wie eine solche persönliche Verbindung von mehr Menschen in Deutschland zu konkreten Konfliktsituationen hergestellt werden könnte. Im Zuge der Partnerschaft würden Schüler aus Rheinland-Pfalz oftmals mehrere Tage mit Schülern in Ruanda zur Schule gehen. Außerdem gäbe es auch Gegenbesuche von ruandischen Schülern in Rheinland-Pfalz. So würden sehr persönliche Verbindungen aufgebaut. Man habe ja zum Beispiel gemerkt, so ein Teilnehmer im Publikum, dass es damals in Rheinland-Pfalz Jugendliche gegeben hätte, die für die Menschen in Ruanda „protestiert, telefoniert und sich engagiert“ hätten.
Ein anderer Vorschlag für die Herstellung von mehr Empathie mit den Opfern von schwersten Menschenrechtsverbrechen kam auch aus dem Publikum: Filme zum Völkermord in Ruanda wie „Shooting Dogs“ oder „Sometimes in April“, so eine Teilnehmerin, hätten ihr die schrecklichen Ereignisse in Ruanda verdeutlicht. „Da habe ich erst gemerkt, was damals alles in Ruanda passiert ist.“ Solche Filme sensibilisierten für das Thema.
➤ 2. Außenpolitik muss transparenter gestaltet werden, um mehr Bürger zu außenpolitischem Engagement zu motivieren.
Viele Menschen in Deutschland fühlten sich mit den komplexen Konflikten in der Welt schlicht überfordert, so ein Ergebnis der Diskussion. „Menschen werden überrollt mit Informationen“, hob Michael Nieden hervor. „Dies führt dazu, dass man apathisch wird. Und hoffnungslos. Wie soll man denn seine Stimme erheben?“ Zu dieser Hilflosigkeit trüge aber auch bei, dass Außenpolitik oft hinter verschlossenen Türen stattfinde und für die meisten Menschen kaum nachvollziehbar gestaltet werde. Es gäbe ein Misstrauen, was von offizieller Seite überhaupt getan oder nicht getan würde, welche anderen Interessen bei politischen Entscheidungen noch eine Rolle spielten. Bei einer solchen Komplexität sei es schwierig, mit Protest überhaupt irgendwo anzufangen.
Ein Schüler im Publikum wies allerdings darauf hin, dass jeder Bürger sich an sein Wahlrecht erinnern solle und entsprechend die Parteien wählen könne, die eine effektivere Politik zur Verhinderung solcher Verbrechen vorschlagen würden. Man könne versuchen Online-Petitionen zu unterschreiben und demonstrieren zu gehen, aber vor allem müsse man auch bei der eigenen Stimmabgabe diese außenpolitischen Aspekte mitbedenken.
➤ 3. Aktuelle Konflikte sollten mehr im Schulunterricht besprochen werden.
Auf Herrn Niedens Frage an die SchüerInnen im Raum, ob aktuelle Krisen auch im Schulunterricht besprochen würden, antwortete ein Schüler, dass bei ihm im Religionsunterricht zumindest die Entführung von über 200 Schulmädchen in Nigeria besprochen wurde. In der Diskussion habe er mit seinen Mitschülern aber auch festgestellt, wie anders Konflikte in Afrika wahrgenommen werden. „Wenn man sich vorstellen würde, dass 200 Schüler irgendwo in der EU entführt worden wären, was da alles in Bewegung gesetzt worden wäre!“
Eine Schülerin erzählte, dass aktuelle Konflikte selbst in Sozialkunde nicht zur Sprache kommen würden. Wenn die Schüler nachfragen würden, ob man über solche Themen reden könne, komme als Antwort eher, „das geht nicht, wir müssen unseren Lehrplan durchbekommen und das passt nicht zum Thema.“
„Wenn wir im Sozialkundeunterricht nachfragen, ob [aktuelle Krisen] im Unterricht besprochen werden können, kommt die Antwort: Das geht nicht, wir müssen den Lehrplan durchbekommen und das passt nicht zum Thema.“
– Schülerin im Publikum
➤ 4. Aufarbeitung und Erinnerung sind wichtig.
Frau Haberer erwähnte als einen wichtigen Beitrag für mehr Engagement zum Thema der Verhinderung schwerster Menschenrechtsverbrechen, dass es wichtig sei, immer wieder an solche Verbrechen zu erinnern. Gedenkstätten und auch Gedenkveranstaltungen seien essentiell um die Erinnerung wach zu halten. Dies habe man auch in Deutschland gelernt.
Abschließende Bemerkungen von Botschafterin Christine Nkulikiyinka
Die Botschafterin der Republik Ruanda in Deutschland, Christine Nkulikiyinka, betonte in ihren abschließenden Bemerkungen nach der Diskussion noch einmal, dass die Berichterstattung zum Völkermord in Ruanda „tatsächlich katastrophal“ war. Dies gelte aber auch noch heute: Wenn man zum Beispiel die Berichterstattung zur Zentralafrikanischen Republik anschaue, würde diese heute auch auf einen Konflikt zwischen Christen und Muslime verkürzt. Wenn man näher hinschaue, wisse man, dass die Situation deutlich komplizierter sei. Man brauche eine größere Bereitschaft, sich mit den „Komplexitäten der Gesellschaften in Afrika vor Ort auseinanderzusetzen.“ Es gäbe aber auch noch ein anderes Problem mit der Berichterstattung: Viele Journalisten in Deutschland seien gleich für das gesamte Afrika südlich der Sahara zuständig. So sei es nicht möglich, dass sich Journalisten ausreichend auskennen würden.
Sie sei „sehr pessimistisch“, was die zukünftige Verhinderung von Völkermord und schwersten Menschenrechtsverbrechen angehe. Man höre oft „wir wollen kein neues Ruanda“ – eine Wortwahl, die RuanderInnen im Übrigen sehr unangenehm sei. Die internationale Gemeinschaft habe aber nichts gelernt. Die Möglichkeiten der Verhinderungen solcher Verbrechen seien begrenzt, solange die globalen Strukturen so blieben wie sie sind. Solange ein Land den Sicherheitsrat blockieren könne, könne man nicht viel erreichen. Ruanda fordere deshalb auch eine Reform des UN-Sicherheitsrats.
„Im Einzelnen und im Kleinen kann jeder etwas bewegen. Wenn es auch nur einem Menschen hilft, ist das schon ein Fortschritt.“
– Botschafterin Christine Nkulikiyinka
Wichtig sei der Botschafterin, aber auch positive Beispiele zu nennen. Man müsse an den Blauhelmsoldaten erinnern, der immer wieder sein Leben aufs Spiel setzte, um möglichst viele Menschen zu retten. An die vielen Menschen in Ruanda, die ihren Nachbarn geholfen hätten. Wenn man diese positiven Beispiele zeige, könnten Einzelne daraus lernen und sich denken: „So etwas kann ich auch tun“. „Im Einzelnen und im Kleinen kann jeder etwas bewegen. Wenn es auch nur einem Menschen hilft, ist das schon ein Fortschritt.“
Über das Projekt

20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda führte Genocide Alert im Jahr 2014 Podiumsdiskussionen, Interviews und einen Essaywettbewerb durch, um an den Völkermord in Ruanda 1994 zu erinnern und daraus zu ziehende Lehren für die gegenwärtige Politik zu debattieren.
Auf dieser Projektseite hat das Team unter Leitung von Sarah Brockmeier Videoaufnahmen von Podiumsdiskussionen und Vorträgen online gestellt, geführte Interviews und Ergebnisse protokolliert sowie Fachliteratur und Gutachten zusammengetragen, unter anderem zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Ruanda.