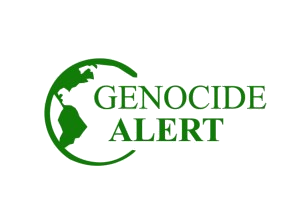Mahnmäler des Vergessens: Was wir von den Statuen zur Erinnerung an die “Trostfrauen” über Geschichtsrevisionismus und Erinnerungskultur lernen können
von Sina Olfermann und Marzia Ley
Schätzungen zum genauen Ausmaß des Systems von “Troststationen” variieren, einige gehen jedoch von bis zu 200.000 Opfern im Alter von elf bis 22 Jahren aus. Diese stammten zu großen Teilen aus Korea, das damals unter japanischer Kolonialherrschaft stand, aber auch aus Taiwan, China, Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Vietnam, Thailand und den Niederlanden. Teilweise wurden sie rekrutiert, nicht selten unter Vortäuschung falscher Tatsachen, teilweise entführt und in die Bordelle verschleppt, wo sie die Moral der japanischen Soldaten verbessern und die Armee effizienter machen sollten.
Zur Erinnerung an das Leid der Mädchen und Frauen und um das gesellschaftliche Tabu um Menschenhandel, sexuelle Gewalt im Krieg und geschlechtsbasierte Gewalt zu brechen, werden mittlerweile vermehrt sogenannte Friedensstatuen aufgestellt, die erste von ihnen in Seoul vor der japanischen Botschaft. Sie stellt ein junges Mädchen in traditioneller koreanischer Kleidung dar, die neben einem leeren Stuhl sitzt und damit einladen soll, sich dem Kampf gegen sexuelle Gewalt anzuschließen.
Nur wenige Stunden, nachdem das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg endgültig entschieden hatte, dass die Friedensstatue, die zum Gedenken an die sogenannten „Trostfrauen“ seit 2020 in Berlin Mitte stand, tatsächlich abgebaut werden muss, wurde diese von einem Privatunternehmen in Begleitung der Berliner Polizei aus dem Ortsteil Moabit entfernt. Unverständnis und Sprachlosigkeit löste das nicht nur wegen des rabiaten Abbaus mit einer Kettensäge aus. Offiziell wurde die Statue zwar deshalb entfernt, weil da die Sondernutzungsgenehmigung des Korea Verbandes, der sie 2020 aufgestellt hatte, abgelaufen ist und nicht verlängert wurde. Einige politische Vertreter:innen warfen dem Berliner Bürgermeister Kai Wegener jedoch vor, mit dieser Entscheidung vor dem Druck der japanischen Regierung eingeknickt zu sein.
Völlig fernliegend ist das nicht. Weltweit gibt es zahlreiche dieser Statuen – darunter in Köln, Wiesent, den USA, Kanada, Australien, China, Taiwan, den Philippinen und vielen weiteren Ländern. Auf ihre Errichtung reagierten Vertreter:innen Japans, teilweise bis in die höchsten Regierungsränge, in fast jedem dieser Fälle mit heftigem Protest und diplomatischem Druck, um die Installation zu verhindern oder rückgängig zu machen.
Das zeigt, dass die Statuen mittlerweile weit mehr sind als ein Symbol für das Leid der „Trostfrauen“. Sie sind zum Schauplatz eines anhaltenden Konflikts um Wahrheit und kollektive Erinnerung avanciert, die mit Ende des 2. Weltkrieges 1945 nicht abschließend verhandelt wurden. Und: Sie verraten viel über eine Erinnerungskultur für Massenverbrechen, der es nicht gelungen ist, Einigkeit über die Ereignisse vor und während des 2. Weltkriegs zu schaffen und damit den Weg zur Versöhnung und Normalisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen zu ebnen.
Der lange Weg in die Erinnerung
Bereits den Begriff „Trostfrauen“ (siehe Infobox) kann man als Ergebnis einer unzureichenden Erinnerungspolitik verstehen. Er übernimmt nicht nur aktiv das Tätervokabular, sondern beschönigt und verschleiert zugleich das, was die Mädchen und Frauen tatsächlich waren: Sexsklavinnen, die das japanische Militär systematisch rekrutierte und verschleppte, um sie in einem System der „Troststationen“, das große Teile Ost- und Südostasiens umspannte, zwangszuprostituieren. Die Opfer wurden dort vergewaltigt, misshandelt, verstümmelt, mit Geschlechtskrankheiten infiziert, ermordet und letztendlich an der Front zurückgelassen, wenn diese fiel. Unter anderem deshalb schafften es viele von ihnen es nie, in ihre Heimat zurückzukehren.
Bei all dem handelt es sich mittlerweile um gut belegte historische Fakten – geschichtsrevisionistischen Stimmen aus Japan zum Trotz. Die Erinnerung an die „Trostfrauen“ steht unter anderem deswegen auf tönernen Füßen, weil sie in den Tokioter Prozessen, also dem japanischen Gegenstück zu den Nürnberger Prozessen, nicht verfolgt wurden. Lediglich das Schicksal von 35 niederländischen Frauen wurde in den B-C-Verhandlungen, also denjenigen für niederrangigere Beschuldigte, verhandelt. In der Zwischenzeit wurde ein signifikanter Teil der Dokumentation des Systems der Zwangsprostitution zerstört oder ging bereits während des Krieges verloren. Eine juristische Aufarbeitung der Schicksale der restlichen hunderttausenden von Frauen fand nie statt.
Nach dem Krieg erfuhren die Betroffenen keinerlei Anerkennung ihres Leids. Vielmehr litten sie unter sozialer Stigmatisierung sowie den anhaltenden körperlichen und psychischen Schäden. All das führte dazu, dass fast 50 Jahre vergehen mussten, bis mit Kim Hak-Sun 1991 die erste der Frauen ihr Schweigen brach und mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit ging.
Einer Erinnerungskultur in Bezug auf japanische Kriegsverbrechen stand nicht nur deren unvollständige Aufarbeitung in den Tokioter Prozessen im Weg. Die USA hielten aus geopolitischen Motiven ihre schützende Hand über den japanischen Kaiser und wirtschaftliche Eliten anstatt für Recht und Gerechtigkeit für die Opfer einzutreten. Die zusammenfassende und übergreifende Darstellung der historischen Ereignisse verwischte das Bild der Gräuel weiter; individuelle Taten und Geschehnisse gingen unter.
Verhandelt wurden während der Tokioter Prozesse in erster Linie die Verbrechen an den westlichen Alliierten. Spätestens mit der damit inhergehenden Umbenennung in den Pazifischen Krieg wurde die Zeitspanne der thematisierten Verbrechen dann klar auf den Zeitraum von 1941–45 begrenzt. Dieses Intervall beginnt mit dem Angriff auf Pearl Harbor und endet mit der Kapitulation nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Kein Teil der Aufarbeitung waren somit: der China-Krieg von 1937–45, über 35 Jahre der Kolonialherrschaft über Korea und die Kriegserfahrungen der Menschen in Ost- und Südostasien, die so aus der Erinnerungskultur verdrängt wurden.
Eine „nationale Amnesie“ und institutionalisiertes Vergessen – die Konsequenzen fehlender Aufarbeitung
Im internationalen Vergleich wird Deutschland oft als Musterbeispiel für Vergangenheitsbewältigung angeführt. Selbst die deutsche Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen war jedoch lange umkämpft und von Kontroversen begleitet. Dennoch entstand über Jahrzehnte hinweg ein Prozess staatlicher wie zivilgesellschaftlicher Selbstkritik, der im Kern auf Verantwortung und Anerkennung setzte. Japan hingegen blieb in vielen Punkten auf Distanz, insbesondere dort, wo es um die eigene Kriegsführung und die Rolle der kaiserlich-japanischen Armee ging. Dass die Tokioter Prozesse nicht die gleiche positive Wirkung auf die Bevölkerung hatten, konnte Madoka Futumara in einer Langzeitanalyse zeigen. Den Ursprung dafür sieht sie einerseits darin, dass es durch die Verhandlungen nicht gelang, ein realistisches Bild der japanischen Kriegsführung zu zeichnen. Andererseits scheiterten sie daran, tatsächliche, individuelle Verantwortung zuzuschreiben. Manche Autor:innen gehen so weit, von einer „nationalen Amnesie“ zu sprechen.
80 Jahre lang bleibt so viel Raum ür Geschichtsrevisionismus. Die japanische Rechte nimmt ihn ein: Mit diplomatischem Druck zur Verhinderung von Gedenkstatuen, mit der Streichung und Kürzung historischer Fakten aus Schulbüchern, mit Politiker:innen-Besuchen des Yasukuni-Schreins, wo 13 verurteilte hochrangige Kriegsverbrecher begraben liegen, mit Ideen eines gerechten japanischen Krieges und der Rückbesinnung auf ein glorreiches Japan. Auch China, Taiwan und Korea, die ihren ganz eigenen, nationalistisch motivierten Geschichtsrevisionismus betreiben, drängen in diesen Raum. Das Thema ist nicht nur ein Instrument, um patriotische und antijapanische Stimmungen zu wecken, es bleibt eine Quelle anhaltender politischer Spannungen zwischen den Ländern.
Darunter leiden in erster Linie die Opfer, nicht zuletzt die „Trostfrauen“, deren Forderungen nach einer Untersuchung der Verbrechen und der Freigabe aller vorhandenen Dokumente, einer offiziellen Entschuldigung und Entschädigung, der Aufnahme der Verbrechen in japanische Geschichtsbücher, dem Bau eines Museums und eines Mahnmals sowie der Verurteilung der Verantwortlichen bislang in keinem der Punkte für sie zufriedenstellend gerecht geworden ist.
Chronisches Ringen um die Wahrheit
Dem entgegen steht eine Vereinbarung zwischen Japan und Südkorea aus dem Jahr 2015, die die Frage der „Trostfrauen“ als „endgültig und irreversibel gelöst“ erklärte. Japan stellte rund eine Billiarde Yen (umgerechnet circa 5,5 Millionen Euro) für die Reconciliation and Healing Foundation bereit, doch die Frauen selbst waren in die Verhandlungen nicht einbezogen worden. Auch fehlte eine klare Anerkennung der staatlichen Verantwortung. Viele der noch lebenden Betroffene lehnten die Zahlungen deshalb ab oder gaben sie zurück. Sie wollten keine mildtätige Geste, sondern Gerechtigkeit.
Dieser politische Umgang steht keinesfalls isoliert da, sondern reiht sich ein in eine geschichtspolitische Linie, die in den vergangenen Jahren unter der Regierung von Premierminister Shinzo Abe weiter verschärft wurde. Abe betonte immer wieder, junge Japaner:innen müssten sich nicht für die Taten ihrer Vorfahren schämen. Unter seiner Führung wurden Darstellungen der Gräueltaten in Schulbüchern abgeschwächt oder ausgelassen, Besuche im Yasukuni-Schrein politisch verteidigt und insgesamt eine Richtung eingeschlagen, die weniger auf Aufarbeitung denn auf Relativierung hinausläuft. Damit wurde die Auseinandersetzung mit den eigenen Kriegsverbrechen nicht vertieft, sondern abgebremst und geschichtsrevisionistischen Positionen weiter der Weg geebnet.
Dass dies international auf Kritik stieß, überrascht kaum. 1998 etwa hatte der UN-Menschenrechtsausschuss Japan aufgefordert, seine Verantwortung uneingeschränkt anzuerkennen und den Überlebenden wirksame Entschädigung zukommen zu lassen. Auch in den Folgejahren mahnten UN-Gremien und Menschenrechtsorganisationen immer wieder an, dass Zahlungen ohne rechtliche Anerkennung und ohne die Stimmen der Betroffenen nicht genügten. Zwar engagieren sich in Japan zivilgesellschaftliche Gruppen für eine ehrliche Aufarbeitung, doch bleibt die „Erinnerungslandschaft in Japan sehr umkämpft“ und geprägt von einer tiefen Kluft zwischen regierungsamtlicher Erinnerungspolitik und gesellschaftlichem Diskurs. Auch in diesem Kontext sind die Versuche asiatischer Diasporas zu verstehen, das Schicksal der „Trostfrauen“ mithilfe der Friedensstatuen in eine globale Erinnerung an die Geschehnisse des 2. Weltkriegs zu rufen und ein eigenes Statement im Ringen um die Wahrheit zu setzen.
Eine Wunde, die nicht heilen kann
All dies macht deutlich: Die Frage der „Trostfrauen“ ist kein historisch abgeschlossenes Kapitel. Sie reicht tief in die Gegenwart hinein: in die regionale Diplomatie Ostasiens, in das internationale Bild Japans und vor allem in das Leben der Überlebenden, die auch nach Jahrzehnten noch darauf warten, dass ihr Leid als Unrecht anerkannt wird. Politische Einigungen, die den Opfern nicht gerecht werden, können keine Versöhnung schaffen. Solange rechtliche Verantwortung verweigert, die Stimmen der Betroffenen übergangen und symbolische Gesten an die Stelle echter Aufarbeitung gesetzt werden, bleibt der Konflikt bestehen und mit ihm die offene Wunde, die die Geschichte bis heute in die Gegenwart trägt.