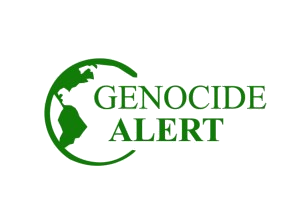Auswirkungen begrenzter Luftschläge auf die syrische Zivilbevölkerung
Genocide Alert Policy Brief, August 2013
Nach dem Giftgaseinsatz am 21. August in Vororten von Damaskus wird eine zeitlich begrenzte militärische Reaktion gegen die syrische Regierung erwogen. Eine derartige Intervention wäre in erster Linie eine Strafaktion, die das Regime von Präsident Assad von künftigen, möglicherweise systematischeren Einsätzen chemischer Waffen gegen die Zivilbevölkerung abschrecken soll. Das vorliegende Papier analysiert die Frage, welche Konsequenzen ein Militäreinsatz für den Schutz der syrischen Zivilbevölkerung haben könnte.
Positive Auswirkungen auf den Schutz der Zivilbevölkerung
Eine Militärintervention könnte den unmittelbaren Zweck haben, die syrische Regierung von weiteren C-Waffen Einsätzen abzuschrecken und so den Schutz der Bevölkerung vor künftigen Attacken zu erhöhen. Unter zwei Bedingungen würden Zivilisten durch eine Intervention vor weiteren Angriffen mit Chemiewaffen geschützt: Erstens, wenn die Luftschläge einen ausreichend hohen militärischen Schaden für die syrische Regierung bewirken; zweitens, wenn die Drohung weiterer Luftschläge im Falle fortgesetzter Giftgas-Angriffen als glaubwürdig wahr-genommen wird.
Eine Zerstörung der syrischen Luftwaffe würde zudem die Möglichkeit Assads einschränken, wie in der Vergangenheit zivil bewohnte Gebiete zu bombardieren. Der syrischen Regierung würde also ein Instrument aus der Hand genommen, mit dem die Bevölkerung unter Missachtung aller einschlägigen Normen des humanitären Völkerrechts seit Jahren terrorisiert wird.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Zivilisten durch Luftschläge unbeabsichtigt zu Schaden kommen, ist als eher gering einzuschätzen, solange sich die USA an dem in Libyen erfolgreich umgesetzten Konzept der „zero expectation“ orientieren. Hiernach wurden Militärschläge nur dann ausgeführt, wenn es keine absehbare Gefahr einer Verletzung oder Tötung von Zivilisten gab.[i] Flugfelder und Raketenstellungen könnten relativ unproblematisch unter Beschuss genommen werden. Zivile Opfer können aber niemals ausgeschlossen werden, zumal die syrische Regierung militärische Stellungen absichtlich in zivil bewohnte Gebiete verlegt hat.
Negative Auswirkungen auf den Schutz der Zivilbevölkerung
Begrenzte Luftschläge können zwar die Fähigkeiten des Regimes verringern, Gewalt gegen die Bevölkerung auszuüben und künftige Gas-Angriffe abschrecken. Sie bieten aber keinen direkten Schutz vor Angriffen, wie es eine Flugverbots- oder Schutzzone könnte.
In jedem Fall ist damit zu rechnen, dass die syrische Regierung Vergeltungsaktionen gegen die eigene Bevölkerung oder die Bevölkerung von Nachbarstaaten unternehmen sowie den bereits heute prekären humanitären Zugang weiter einschränken könnte. Ebenfalls denkbar wäre eine noch systematischere Ausnutzung der eigenen Bevölkerung als menschliche Schutzschilde oder eine Geiselnahme von UN-Mitarbeitern.
Die Auswirkungen auf den Konfliktverlauf sind zudem ungewiss. Das militärische Kräfteverhältnis würde durch ein kurzfristiges Eingreifen zum Vorteil oppositioneller Kräfte verändert, die sich in der Vergangenheit ebenfalls Menschenrechtsverletzungen begangen haben, wenn auch in geringerem Ausmaß als das Assad Regime. Eine weitere Eskalation des Bürgerkriegs kann ebenso wenig ausgeschlossen werden wie eine Dynamik, Friedensgespräche wie im Fall Bosnien 1995 aufzunehmen. Dies ist jedoch von einer erneuten diplomatischen Initiative unter Einbeziehung Russlands und des Irans abhängig.
Erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung
Um zivile Opfer als Folge von Luftschlägen zu vermeiden, sind sorgfältige Aufklärung, Pla-nung und Durchführung der Angriffe erforderlich. Der Schutz der Zivilbevölkerung muss hierbei oberste Priorität haben und sollte nicht durch militärischen Zeitdruck eingeschränkt werden. Wie in Libyen sollte jede militärische Operation nur dann durchgeführt werden, wenn zivile Opfer mit höchster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Zudem bedarf es klarer Mechanismen, um Informationen zu möglichen zivilen Opfer zu erhalten und öffentlich machen zu können. Im Gegensatz zu Kombattanten, werden getötete Zivilisten bisher kaum durch die Streitkräfte gezählt und erfasst.
Um die Situation der Bevölkerung mittelfristig zu verbessern, ist ein Neustart von Gesprächen notwendig. Die Bundesregierung sollte hier die Initiative ergreifen und eine direkte Vermittlung zwischen dem Westen und Russland, bestenfalls auch dem Iran, anstreben. Die durch ein Eingreifen neu geschaffene Konflikt-Dynamik sollte zum Anlass genommen werden, die für alle Seiten zunehmend inakzeptable Situation in Syrien auf diplomatischem Weg zu lösen.
Kurzfristig ist damit zu rechnen, dass die bereits jetzt dramatisch hohen Flüchtlings-zahlen in Folge eines Militäreinsatzes weiter zunehmen könnten. Bereits heute ist ein Viertel der syrischen Bevölkerung Binnenvertriebene. Über eine Million Kinder wurden durch den Bürgerkrieg zu Flüchtlingen. Derzeit wird zu wenig humanitäre Hilfe nach Syrien und in dessen Nachbarstaaten geliefert. Eine Intervention müsste daher mit einer deutlichen Aufstockung humanitärer Hilfsleistungen sowie größerer Unterstützung für die Nachbarländer einhergehen. Nachdem die Staaten in der Region unter großen Anstrengungen für eine Aufnahme von Flüchtlingen gesorgt haben, sollte nun auch Europa eine größere Aufnahmebereitschaft gegenüber Flüchtlingen zeigen.
Autoren:
Dr. Robert Schütte ist Vorsitzender von Genocide Alert
Christoph Schlimpert ist stellvertretender Vorsitzender von Genocide Alert
Kontakt: info@genocide-alert.de
Genocide Alert e.V., August 2013
[i] Der Untersuchungsbericht des UN Menschenrechtsrates hatte hierzu folgendes festgestellt:
“NATO aircraft flew a total of 17,939 armed sorties in Libya, employing precision guided munitions exclusively. NATO told the Commission that it had a standard of “zero expectation” of death or injury to civilians, and that no targets were struck if there was any reason to believe civilians would be injured or killed by a strike. (…)Despite precautions taken by NATO as described above, the Commission notes incidents of civilian deaths and damage to civilian infrastructure. Amongst the 20 NATO airstrikes investigated, the Commission documented five airstrikes where a total of 60 civilians were killed and 55 injured.” (http://www.ohchr.org/../A_HRC_19_68_en.doc; para. 84, 87)