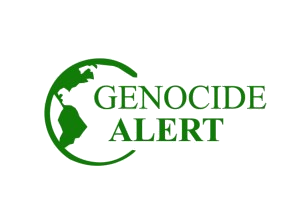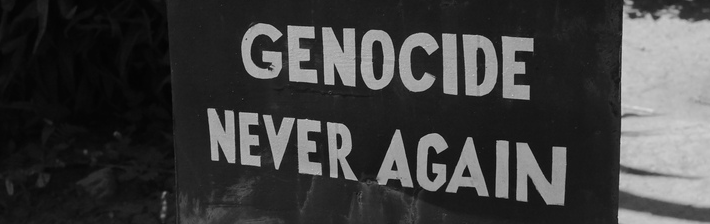Früher handeln statt später bedauern: Bilanz nach fünfzehn Jahren Schutzverantwortung
Häufig scheren sich Konfliktparteien in bewaffneten Konflikten kaum um die Leben von Zivilistinnen und Zivilisten. Auch in Friedenszeiten kommt es im Rahmen von „Aufstandsbekämpfung“ immer wieder zu schwersten Menschenrechtsverletzungen, wie der Massenexodus der Rohingya aus Myanmar zeigte.
Eigentlich, so die Hoffnung vor einigen Jahren, sollten Massenverbrechen wie der Völkermord in Ruanda 1994 oder die Gräueltaten der Bürgerkriege in den 1990ern und frühen 2000ern der Vergangenheit angehören. Hatten doch beim Reformgipfel der Vereinten Nationen 2005 Staats- und Regierungschefs einstimmig eine sogenannte Schutzverantwortung akzeptiert (engl. Responsibility to Protect oder R2P). Demnach habe jeder Staat die Verantwortung, seine Bevölkerung vor Massenverbrechen wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu schützen. Die internationale Gemeinschaft solle die Staaten dabei unterstützen. Scheitere ein Staat darin massiv, stehe die Staatengemeinschaft bereit, durch den UN-Sicherheitsrat zu reagieren.
Der Beschluss wurde seinerzeit als eine der bedeutendsten Entwicklungen der jüngeren Weltpolitik gefeiert. Manche sahen eine völkerrechtliche Revolution heraufziehen: Der Schutz des Individuums werde gegenüber einer staatszentrierten Souveränitätskonzeption gestärkt. 15 Jahre später ist es an der Zeit Bilanz zu ziehen: Ist die Schutzverantwortung wirkungsmächtig geworden?
Bilanz der Schutzverantwortung
In der breiten Öffentlichkeit wurde das Konzept der Schutzverantwortung erst ab 2011 diskutiert, im Kontext der Libyen-Intervention und der Gräueltaten in Syrien. Kurz darauf wurde ihr bereits das frühe Ende bescheinigt. Schließlich hatten die NATO und ihre Verbündeten in Libyen ihr UN- Mandat überdehnt. Anstatt militärische Gewalt nur zum Schutz der Zivilbevölkerung vor der libyschen Regierung anzuwenden, hatten sie im Bürgerkrieg Partei ergriffen und das Gaddafi-Regime gestürzt. Der Vorwurf der unrechtmäßigen Einmischung wurde laut. In Syrien stand die Staatengemeinschaft dann tatenlos daneben, während aus der gewaltsamen Niederschlagung regierungskritischer Demonstrationen ein brutaler Bürgerkrieg erwuchs, in dem das Regime nicht einmal vor dem Einsatz chemischer Waffen zurückschreckte.
Beide Konflikte betten sich ein in einen breiteren Trend: Die Zahl bewaffneter Konflikte weltweit steigt seit zehn Jahren fast kontinuierlich an. 128 Kriege und bewaffnete Konflikte zählt die Konfliktdatenbank der Universität Uppsala 2018. Eine verschwindend geringe Zahl von Kriegen ist heute noch „klassischer“ zwischenstaatlicher Natur. Mehr als drei Viertel sind bewaffnete Konflikte zwischen verschiedenen nichtstaatlichen Gewaltakteuren oder den jeweiligen nationalen Regierungen und bewaffneten Gruppen im Land. Hinzu kommen noch internationalisierte innerstaatliche Konflikte, in denen Konfliktparteien Unterstützung von anderen Staaten erhalten.
Viele der großen Gewaltkonflikte sind durch massive Gewalt gegen Zivilistinnen und Zivilisten geprägt. Es kommt zu Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen, Massakern an ganzen Dörfern, sexualisierter Gewalt. Beleg hierfür ist auch die steigende Zahl von Menschen, die vor Krieg und Gewalt flüchten. Im Jahr 2018 wurden laut UN-Flüchtlingshilfswerk jeden Tag durchschnittlich 37.000 Menschen gewaltsam vertrieben.
Doch dies sind nicht die einzigen Massenverbrechen. Beispiel Myanmar: Der Internationale Gerichtshof hatte die dortige Regierung im Januar 2020 aufgefordert, die muslimische Minderheit der Rohingya vor einem möglichen Völkermord zu schützen. Polizei und Militär in Myanmar waren unter dem Mantel der Terrorismusbekämpfung ab August 2017 gegen die Rohingya vorgegangen. Es kam zu Tötungen, Vergewaltigungen und Brandschatzungen. Über 700.000 Menschen flohen in Richtung Bangladesch. Eine Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates wirft den Behörden eine genozidäre Absicht vor, d.h. eine geplante Zerstörung der Rohingya-Gemeinschaft in Myanmar. Der UN-Sicherheitsrat reagierte darauf jedoch nicht.
Die Gründe für dieses Scheitern der Staatengemeinschaft in der Reaktion auf Massenverbrechen sind vielfältig: Die Debatte darüber, wie die Schutzverantwortung umgesetzt werden soll, wird in den Vereinten Nationen nach wie vor sehr kontrovers geführt. Viele Staaten unterstützen zwar rhetorisch die Idee hinter der Schutzverantwortung, stehen aber internationaler Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten weiter kritisch gegenüber und wollen ihre Souveränität geschützt sehen. Die Intervention der NATO in Libyen 2011 dient ihnen als negatives Beispiel. Zudem ist der UN-Sicherheitsrat durch Interessenkonflikte der Großmächte immer wieder blockiert. Die zunehmende Fragmentierung der Konfliktlandschaft erschwert eine effektive internationale Konfliktbearbeitung. Gleichzeitig schwächt der weltweite Aufschwung populistisch-nationalistischer Strömungen den Multilateralismus im Allgemeinen. Die Bereitschaft zu kollektivem, gegebenenfalls gar militärischem, Handeln, um „entfernten Fremden“ zu helfen, sinkt zunehmend.
Dies zeigt sich auch daran wie der UN-Sicherheitsrat die Schutzverantwortung in seiner Arbeit aufgreift. Zwar bezog er sich zwischen 2005 und Ende 2019 über 80 Mal in Resolutionen auf das Konzept, mandatierte dabei aber überwiegend souveränitätsfreundliche, unterstützende Maßnahmen wie Friedenssicherung, Vermittlung oder Hilfe bei Stabilisierung und Staatsaufbau. Libyen bleibt bis dato der einzige Fall, in dem der Sicherheitsrat Mitgliedstaaten ermächtigt hat, ohne die Zustimmung des betroffenen Staates Gewalt anzuwenden, um Zivilisten zu schützen.
Die R2P erweist sich somit nicht als Instrument zum Schutz der Verfolgten, sondern eher als Richtlinie, dass der Sicherheitsrat irgendetwas tun müsse im Angesicht von Massenverbrechen. Dabei beschränkt er sich jedoch zu häufig auf eine reine Diskussion der Angelegenheit. Kritiker attestieren der Schutzverantwortung daher Wirkungslosigkeit.
Trotzdem ist die Bilanz nach 15 Jahren Schutzverantwortung nicht vollständig negativ. Die Schutzverantwortung ist nicht mit militärischen humanitären Interventionen gleichzusetzen. Das UN-Sekretariat, einige Staaten und Nichtregierungsorganisationen bemühen sich angesichts der Umstrittenheit des Themas, die Diskussion zu verschieben: weg von der Reaktion auf Massenverbrechen und dem Einsatz von Zwang, hin zur frühzeitigen Prävention von Massenverbrechen, in Zusammenarbeit mit den Regierungen und Zivilgesellschaften der betroffenen Länder. Damit rücken die Konfliktvorsorge – Prävention – und Konfliktnachsorge – Peacekeeping und Peacebuilding – in den Fokus der Debatte über die Verhinderung von Massenverbrechen.
Peacekeeping und Peacebuilding in der Prävention von Massenverbrechen
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon und das UN-Büro zur Prävention von Völkermord und zur Schutzverantwortung haben sich bereits in den ersten Jahren nach dem Beschluss von 2005 für ein Mainstreaming der Schutzverantwortung in der UN konzentriert, d.h. eine Berücksichtigung ihrer Ziele in existierenden Programmen, Maßnahmen und Instrumenten vorangetrieben. Die seit 2009 jährlich veröffentlichten Berichte des UN-Generalsekretärs zur Umsetzung der Schutzverantwortung konzentrieren sich überwiegend auf die frühzeitige Prävention von Massenverbrechen. António Guterres setze dies fort. Er drängte die Staaten dazu, die Umsetzung der Schutzverantwortung mit bestehenden institutionalisierten Mechanismen und Institutionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte und der Achtung des humanitären Völkerrechts voranzutreiben. Ab 2018 verband er die Schutzverantwortung mit seiner umfassenderen Agenda zur Konfliktprävention. In seinem jüngsten Bericht zur Schutzverantwortung 2019 legte er das Augenmerk auf Lehren aus der Prävention, auf Maßnahmen die ein (Wieder)auftreten von Massenverbrechen verhindern können.
Der Schutz von Zivilisten durch Friedensmissionen ist ein wichtiger Aspekt der Umsetzung der Schutzverantwortung durch die UN. Nahezu alle der seit 1999 neu beschlossenen UN-Friedensmissionen haben die Aufgabe, Zivilisten zu schützen. In Resolutionen zu Darfur, Elfenbeinküste, der Demokratischen Republik Kongo, Südsudan, Mali und der Zentralafrikanischen Republik finden sich direkte Bezüge auf die Schutzverantwortung. Zwar fehlt es UN-Friedensmissionen häufig an Ressourcen, entsprechender Ausbildung der Truppen und einer einheitlichen Auslegung des Mandats durch die truppenstellenden Staaten, was ihre Möglichkeit effektiv auf Massenverbrechen zu reagieren reduziert. Studien zeigen jedoch, dass die bloße Präsenz von Blauhelmen vor Ort Gewalt gegen Zivilisten reduzieren kann.
Darüber hinaus sind viele der von der UN und Experten vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung der Schutzverantwortung und zur Prävention von Massenverbrechen im Grunde Maßnahmen des Peacebuildings, die sich in der Konfliktnachsorge bewährt haben: Staaten sollten effektive, legitime und integrative Regierungsführung fördern und ihre Sicherheitssektoren in einer Weise reformieren, die die grundlegenden Menschenrechte achtet. Zudem sollten sie Rechtsstaatlichkeit garantieren und partizipatorische und rechenschaftspflichtige politische Institutionen sowie den gleichberechtigten Zugang zur Justiz fördern. Auch Mechanismen für die faire und transparente Verwaltung von wirtschaftlichen Ressourcen sowie die Förderung von Dialog zur Konfliktlösung und Versöhnungsprozessen auf lokaler Ebene werden als Instrumente benannt. Peacebuilding ist zentral, um Massenverbrechen zu verhindern. Es sollte jedoch nicht erst nach Konflikten zum Einsatz kommen, sondern immer dort, wo sich Risikofaktoren zeigen.
Denn Forschung zu Risikofaktoren für Massenverbrechen unterstreicht: Schwerste Gräueltaten treten nicht plötzlich auf. Ein gesellschaftliches Klima, in dem solches Handeln denkbar und möglich wird, entwickelt sich langsam. Warnzeichen sind systematische Diskriminierung, Exklusion bestimmter Gruppen, ungleicher Zugang zu Ressourcen und wirtschaftliche Benachteiligungen von Teilen einer Gesellschaft. Spaltet sich die Gesellschaft kann dies auch in Friedenszeiten zu Gewalt führen, wenn Agitatoren die Bevölkerung aufhetzen. Es gilt daher gesellschaftliche Ursachen für Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen anzugehen, um eine Gesellschaft resilienter gegenüber solchen Risiken zu machen. Dazu gehört auch die Aufarbeitung vergangener Gewaltexzesse. Gesellschaften, in denen es zu Völkermorden oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit kam, haben ein größeres Risiko, dass sich solche Verbrechen wiederholen.
Handeln statt bedauern!
Konzeptionell ist die Schutzverantwortung also breit ausgearbeitet. Es existieren inzwischen auch diverse zwischenstaatliche Formate, in denen sich Staatenvertreter und Nichtregierungsorganisationen über Maßnahmen zur Prävention von Massenverbrechen austauschen und Ausbildungsprogramme auflegen. Über 60 Staaten haben inzwischen sogenannte R2P Focal Points ernannt, die die Tätigkeiten ihrer Regierung mit Bezug zur Schutzverantwortung koordinieren sollen.
Nun gilt es dies auch in konkretes Handeln zu übersetzen. UN-Generalsekretär António Guterres kritisierte 2019 zu Recht eine „wachsende Kluft zwischen dem Bekenntnis des Weltgipfels von 2005 zur Schutzverantwortung und der täglichen Erfahrung von gefährdeten Bevölkerungsgruppen“ weltweit.
Dies erfordert eine veränderte Prioritätensetzung in der Außenpolitik und der Entwicklungszusammenarbeit. Werden entsprechende Risiken erkannt, muss viel früher diplomatisch Einfluss auf die Regierungen betroffener Staaten genommen werden, auch wenn darunter andere Interessen leiden könnten. Eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung von UN-Friedensmissionen könnte Menschen in unmittelbarer Gefahr schützen und helfen, ein Wiederausbrechen von Gewalt nach Konflikten zu verhindern.
Die Beschäftigung mit Massenverbrechen darf nicht erst einsetzen, wenn Politikerinnen und Politiker ihr tiefes Bedauern zum Ausdruck bringen, sondern ist notwendig bevor es zu Gewalt kommt.
Dieser Beitrag wurde in der Zeitschrift Neue Gesellschaft | Frankfurt Hefte (Ausgabe 5/2020) veröffentlicht. Wir danken für die Erlaubnis zur Zweitveröffentlichung.
Autor: Gregor Hofmann