Interview der Tagesschau mit Genocide Alert Experten zur Krise im Ostkongo
Der Ostkongo wird seit Jahren mit Gewalt überzogen. Die Ursache dafür liege vor allem in ethnischen Konflikten, sagt der Politologe Christoph Vogel. Im Interview mit tagesschau.de erklärt er zudem, warum die UNO in der Region gescheitert ist – und welche undurchsichtige Rolle Ruanda in dem Konflikt spielt.
tagesschau.de: Die Bilder scheinen sich alle Jahre zu wiederholen: Zehntausende Menschen auf der Flucht, Rebellen und Regierungstruppen, die einander bekämpfen. Warum kommt der Osten Kongos seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe?
Christoph Vogel: Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Demokratische Republik Kongo als Staat nicht in der Lage, ihr Territorium zu sichern, die Zivilbevölkerung zu schützen – geschweige denn, ihre militärischen Gegner in die Schranken zu weisen. Hinzu kommt: Es gab bei den zahlreichen Konflikten in den vergangenen 20 Jahren immer wieder Einflussnahme von Nachbarstaaten, mal mehr, mal weniger.
Mit dem jetzigen Vorstoß der M23-Rebellen ist die Debatte um Ruandas Einfluss wieder entbrannt. Ruanda spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle, aber wie direkt die Unterstützung Ruandas ist und ob die Befehlskette innerhalb der Rebellengruppe M23 bis zum ruandischen Verteidigungsminister reicht – das lässt sich schwer beweisen. Da wird viel spekuliert.
Verbindungen zum Völkermord von Ruanda
tagesschau.de: Welche Interessen hat Ruanda denn im Kongo?
Vogel: Das reicht zurück bis zum Völkermord von 1994, als Hunderttausende Tutsi in Ruanda ermordet wurden. Viele der damaligen Mörder waren über die Grenze in den Kongo geflüchtet – und die ruandische Regierung will diese dingfest machen. Dabei handelt es sich um Hutu-Milizen. Die M23 hingegen wird von kongolesischen Tutsi befehligt und kontrolliert, als deren Schutzmacht sich Ruanda wiederum versteht.
Der ruandische Präsident Paul Kagame ist selbst Tutsi und hatte in den 1990er-Jahren den Kampf gegen die Hutu unterstützt. Und diese „Jagd“ setzt sich im Nachbarland Kongo fort. Da wird dann behauptet, die „nationale Sicherheit Ruandas“ sei bedroht, oder es gehe um den Schutz der „Brüder und Schwestern“ auf der anderen Seiten der Grenze.
Angesichts der Unfähigkeit der kongolesischen Armee sind die M23-Rebellen aus Sicht Ruandas gewissermaßen Verbündete, um die alten Feinde zu bekämpfen. Hinzu kommen natürlich wirtschaftliche Interessen. In der Region lagern viele Bodenschätze, unter anderem werden dort Coltan oder Wolfram abgebaut. Trotz verschiedener internationaler Versuche, den Schmuggel einzudämmen, spielt der illegale Handel mit Rohstoffen zwischen Ruanda und Ostkongo nach wie vor eine große Rolle. Denn Ruanda ist für diese Rohstoffe auch ein wichtiges Transitland.
„Auswirkungen der kolonialen Grenzziehung“
tagesschau.de: Sie haben die ethnischen Spannungen und den Kampf um die Ressourcen erwähnt. Was wiegt Ihrer Ansicht nach schwerer – und entfacht den Konflikt immer wieder?
Vogel: Die Rohstoffe sind nicht die eigentliche Ursache des Kriegs, sondern sie begünstigen, dass er immer weitergehen und sich weiter finanzieren kann. Hauptursache sind die koloniale Grenzziehung und die sogenannte Ethnisierung von außen. Denn Huti und Tutsi sind streng genommen keine verschiedenen Ethnien, wurden aber in der Kolonialzeit als solche klassifiziert. Das hat Auswirkungen bis heute.
Hinzu kommt, dass es nicht nur ein Problem zwischen Hutu und Tutsi gibt, sondern auch zwischen den vielen anderen Ethnien, die in der Grenzregion Ostkongo/Ruanda vertreten sind. Und diese Spannungen entzünden sich vor allem an einer Landfrage. Der Ostkongo beispielsweise ist eine der am dichtesten besiedelten Gegenden in der gesamten Region – und auch Ruanda leidet an Platzmangel. Schon seit jeher gab es in dieser Region Landkonflikte, was politisch missbraucht wird und den Konflikt zusätzlich anfeuert.
„Kabila weitgehend abgetaucht“
tagesschau.de: Jenseits dieser Ursachen – wie verhalten sich die kongolesische Regierung und Präsident Joseph Kabila in dem Konflikt? Will er überhaupt Frieden in der Region?
Vogel: Das ist wahrscheinlich eine der kniffligsten Fragen, auf die es derzeit fast keine passende Antwort gibt. Kabila ist weitgehend untergetaucht, abgesehen von einem Fernsehinterview. Es gibt zahlreiche Gerüchte, dass der schwelende Bürgerkrieg ihm und seinen Familienmitgliedern in die Hände spielt. Denn es gibt immer wieder Indizien – auch in den Berichten der UNO -, dass seine Entourage in den Rohstoffhandel involviert ist.
Aber welches Interesse der Präsident tatsächlich verfolgt, ist schwer zu sagen, da er nahezu unsichtbar ist und wenige Informationen aus seinem Umfeld nach außen dringen. Er verfügt zwar über eine Armee; die ist aber in einem derart desolaten Zustand, was die Kommandostrukturen betrifft, dass sie auch gegen kleine, straff organisierte Rebellengruppen wie die M23 wenig ausrichten kann.
tagesschau.de: Und auch die UNO, die im Ostkongo mit bis zu 19.000 Soldaten vertreten ist, scheint nichts bewirken zu können. Wieso?
Vogel: Obwohl es sich bei der Kongo-Mission um den größten UN-Einsatz handelt, ist es für die Blauhelmsoldaten extrem schwierig, in einem Staat mit der Fläche von 2,3 Millionen Quadratkilometern für Ordnung zu sorgen – allein schon was die finanziellen und personellen Mittel angeht. Und die Konfliktlage ist derart verworren, dass es nicht reicht, die widerstreitenden Parteien voneinander zu trennen. Es geht darum, eine Staatlichkeit wiederherzustellen.
Die UNO hat dafür ein sehr komplexes Mandat für den Kongo, das bei genauerem Hinsehen aber kaum durchführbar ist. Der erste Kernpunkt ist der Schutz der Zivilbevölkerung, der zweite die Unterstützung der staatlichen Autoritäten. Der letzte Punkt hatte beim Marsch der Rebellen auf Goma aber zur Folge, dass sich die UNO nicht eingemischt hat, weil die kongolesischen Soldaten sehr schnell geflohen sind und sich ergeben haben.
Somit gab es im Prinzip niemanden mehr, den die Blauhelmsoldaten unterstützen konnten. Denn die UNO ist nicht dazu befugt, alleine einen Verteidigungskrieg zu führen, sondern nur unterstützend für die kongolesische Armee.
tagesschau.de: Sehen Sie irgendeine Chance auf Frieden in der Region?
Vogel: Im Moment erscheint mir das sehr schwierig, weil die kongolesische Regierung und M23 nicht zu Verhandlungen bereit sind. Vor allem die kongolesische Regierung scheint das zu blockieren. Nur wenn es Zugeständnisse aller Seiten gäbe und einen Dialog aller Beteiligten – und nicht nur derjenigen, die zurzeit an der Macht sind – hätte ein Frieden vielleicht eine Chance. Dann könnte sich mit vorsichtiger internationaler Unterstützung vielleicht etwas bewegen. Aber danach sieht es leider an allen Fronten nicht aus.
Christoph Vogel hat Politikwissenschaft und Afrikanistik an der Universität Köln sowie Peace and Conflict Studies an der Makerere University in Kampala studiert. Er forschte über bewaffnete Konflikte und humanitäre Hilfe im Kongo, in Uganda, Burundi und Haiti sowie bei der UNO. Vogel ist Stipendiat der Stiftung Mercator und seit 2011 Mitarbeiter von Genocide Alert.
Das Interview führte Jörn Unsöld, tagesschau.de.
Das Interview auf tagesschau.de hier.
Das Kurz-Video mit Interview hier.
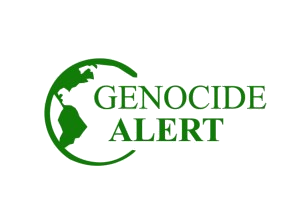



 Nach der Eroberung Gomas bleibt die Lage in Bezug auf Sicherheit und Versorgung in beiden Kivuprovinzen prekär. Sollte sich die kongolesische Regierung weiterhin sperren, Verhandlungen mit M23 einzugehen, so drohen diese, auch die Provinzhauptstadt des Südkivu, Bukavu, einzunehmen. Ein gesteigertes militärisches Potential (von anfangs ca. 400 auf nunmehr etwa 2000 straff organisierte und gut ausgerüstete Soldaten) lassen diese Ankündigung realistisch erscheinen. Ginge die Regierung auf das Verhandlungsangebot ein, wäre eine friedvolle Lösung möglich, doch diverse Hindernisse lassen diese Option unwahrscheinlich werden: Einerseits ist es nach der Eskalation der vergangenen Monate kaum mehr denkbar, dass sanktionierte Individuen wie Sultani Makenga, Baudouin Ngaruye oder Innocent Kaina (die militärischen Anführer von M23) in die Regierungsarmee zurückintegriert oder amnestiert werden. Andererseits würde ein Kuhhandel zwischen Regierung und M23, die beide in Großteilen der Kivuprovinzen als illegitime Kräfte betrachtet werden, eine Gewaltspirale auslösen, da Gruppierungen wie Nyatura, FDLR, APCLS, die verschiedenen Raia Mutomboki und diverse andere Mayi Mayi Milizen jenes kaum akzeptieren würden. Eine Graphik zeigt eine ungefähre Verteilung der wichtigsten bewaffneten Gruppen der Region und illustriert die zuvor geschilderte Gefahr.
Nach der Eroberung Gomas bleibt die Lage in Bezug auf Sicherheit und Versorgung in beiden Kivuprovinzen prekär. Sollte sich die kongolesische Regierung weiterhin sperren, Verhandlungen mit M23 einzugehen, so drohen diese, auch die Provinzhauptstadt des Südkivu, Bukavu, einzunehmen. Ein gesteigertes militärisches Potential (von anfangs ca. 400 auf nunmehr etwa 2000 straff organisierte und gut ausgerüstete Soldaten) lassen diese Ankündigung realistisch erscheinen. Ginge die Regierung auf das Verhandlungsangebot ein, wäre eine friedvolle Lösung möglich, doch diverse Hindernisse lassen diese Option unwahrscheinlich werden: Einerseits ist es nach der Eskalation der vergangenen Monate kaum mehr denkbar, dass sanktionierte Individuen wie Sultani Makenga, Baudouin Ngaruye oder Innocent Kaina (die militärischen Anführer von M23) in die Regierungsarmee zurückintegriert oder amnestiert werden. Andererseits würde ein Kuhhandel zwischen Regierung und M23, die beide in Großteilen der Kivuprovinzen als illegitime Kräfte betrachtet werden, eine Gewaltspirale auslösen, da Gruppierungen wie Nyatura, FDLR, APCLS, die verschiedenen Raia Mutomboki und diverse andere Mayi Mayi Milizen jenes kaum akzeptieren würden. Eine Graphik zeigt eine ungefähre Verteilung der wichtigsten bewaffneten Gruppen der Region und illustriert die zuvor geschilderte Gefahr.