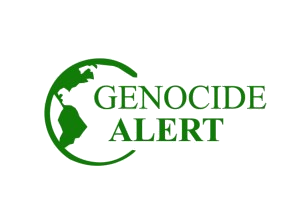Der Genozid der anderen – von Matthias Meyer
Zweiter Platz beim Essaywettbewerb “20 Jahre danach –
Was sind die Lehren aus dem Völkermord in Ruanda”
Selbstverständlich, Ruanda ist weit weg. Der Zweite Weltkrieg auch. Konzentrationslager voller aufgestapelter Leichen, Opfer eines Völkermordes. Nie wieder hieß es damals 1945, nie wieder. Viele Jahre ist das her, viele Jahre, in denen dieses Vorhaben hätte umgesetzt werden können. Doch die Realität ist von dieser Vorstellung noch viel weiter entfernt, als es Deutschland von Ruanda ist. Massengräber voller aufgestapelter Leichen 1994 in Ruanda, Opfer eines Völkermordes: Nie wieder, hieß es 50 Jahre nach dem Holocaust erneut: Nie wieder darf so etwas geschehen, nie wieder dürfen Hunderttausende Menschen einfach abgeschlachtet werden. Selbstverständlich nicht.
Und irgendwie war es doch wieder passiert in einer Zeit kurz nach dem Kalten Krieg und lange nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Weltfrieden plötzlich möglich schien. Trotz aller guten Zielsetzungen eskalierte in einem kleinen Staat irgendwo in Afrika ein Jahrzehnte alter Streit zwischen den Bevölkerungsgruppen Tutsi und Hutu in einen Genozid. In annähernd 100 Tagen töteten auf dem Höhepunkt des Konflikts, der seit der deutschen und belgischen Kolonialzeit schwelte, Angehörige der Hutu-Mehrheit einen Großteil der in Ruanda lebenden Tutsi-Minderheit. Plötzlich war sie wieder da: die scheinbar nicht zu bändigende Gewalt, die tausendfach mordet. Gruppen voller Hass, Gräber voller Massen. Und Europäer und Amerikaner voller Kurzsichtigkeit. Die Signale hätten gesehen werden können: Die Waffenexporte hatten sich vor dem Genozid drastisch erhöht, ruandische Offiziere berichteten von umfassenden Vorbereitungen von Mordkommandos. Doch Ruanda war Milliarden von Menschen zu weit weg, als dass man eingegriffen hätte. Die großen Vorsätze in der Folge des Holocaust waren es vielleicht auch.
Dieses Nichtstun, diese Passivität, hat dazu geführt, dass sich die Geschichte entsetzlich wiederholte. Es lässt einen ratlos dastehen.
Was sollte man schon schreiben über das Schreckliche? Dass es schrecklich ist? Dass das Unmenschliche unmenschlich ist? Sätze wie diese, sie wirken so banal, sie wirken so ausgehöhlt. Wenn Menschengruppen andere Menschengruppen foltern und auslöschen aus den wahnwitzigsten Gründen, dann fehlen die Worte. Dann ist das Geschehene zu brutal, das Leid zu groß, um es zu fassen. 700 000 Tote. 800 000 Tote. 1 000 000 Tote. Gerne werden, wenn beim Thema Genozid Wörter nicht mehr ausreichen, die großen Opferzahlen genannt, die beeindrucken sollen mit all ihren Nullen. Aber warum war die Zahl 6 000 000, die sich wegen der Nazi-Verbrechen in die Gedächtnisse der Menschen eingebrannt hat, nicht schon beeindruckend genug? Vielleicht weil solche Zahlen nicht mehr vorstellbar sind für das menschliche Gehirn. Vielleicht weil die Zahlen, ein abstraktes Objekt des menschlichen Denkens, die vielen Einzelschicksale zu sehr reduzieren, als dass sie schockieren.
Es gibt keine Sprache, die einem Genozid angemessen ist. Unmöglich ist es als Außenstehender, dem Leid der Menschen, der Hoffnung und Träume der Menschen, die jetzt nicht mehr Leben, den vielfältigen Individuen, die die Welt einst bereicherten, mit Sätzen – egal welcher Art – Rechnung zu tragen. Einen Text zu schreiben, der sich dessen anmaßt, wäre ignorant. Mit dem dauerhaften Schwelgen in – oft auch durchaus ernst gemeinter – Betroffenheit und dem fortwährenden gegenseitigen Überbieten an möglichst bestürzenden Beschreibungen ist letztlich kein Fortschritt möglich. Vielmehr haben wir die Möglichkeit, mit unseren Sätzen möglichen zukünftigen Opfern gerecht zu werden, wenn uns bei denen der Vergangenheit schon verwehrt bleibt, indem wir weitere Massenmorde verhindern. Ehrliche und ernst gemeinte Schlüsse, wie sie auch schon aus dem Holocaust, dem Völkermord in Ruanda und anderen Genoziden gezogen wurden – nur leider in zu geringer Anzahl -, bergen die Chance, dass sich dieses Mal der Satz „Nie wieder!“ bewahrheitet.
Ein Wegschauen, ein Ignorieren des Genozids, auch wenn er primär nur die anderen trifft, mag zwar verständlich sein, ist aber umso fataler. Moralisch verwerflich aber in jedem Fall. Vielleicht zeigt sich bei einem solchen Verhalten eine Art Schutzmechanismus, ein Verleugnen und Nicht-Wahrhaben-Wollen, da ein Genozid zu brutal erscheint, als dass er möglich sein könnte. Ein Nachdenken darüber, ob man nicht selbst so reagieren würde, ändert nichts an den Geschehnissen in Ruanda, lässt sie aber nicht völlig umsonst erscheinen.
Von zwanzig Jahren Genozid in Ruanda wird dieser Tage zu Recht gesprochen. Es ist nicht der Genozid vor zwanzig Jahren. Ein Genozid endet nicht einfach mit den Verbrechen, darf nicht enden und in Vergessenheit geraten, denn er muss weiterleben als Lehren und Gedanken in den Köpfen der Menschen. Noch schlimmer als die vielen abscheulichen Taten wäre, dass daraus keine Schlüsse gezogen werden würden, dass Menschen eine Wiederholung der Geschichte zulassen würden.
Ein Genozid geschieht nicht einfach, er bahnt sich an. Wer Waffen in gefährdete Regionen exportiert, riskiert einiges; wirtschaftliche Interessen sind nicht immer ein guter Ratgeber. Es gibt jedoch keine Pflicht, irgendetwas zu tun oder nicht zu tun, sondern nur eine Verantwortung. Eine Verantwortung für ein gemeinschaftliches Mit- und Füreinander. Und die verlangt, dass – wenn Menschen zu Tausenden abgeschlachtet werden – Gewalt abwendend durch Vermittlung auf Gesprächsbasis und im äußersten Notfall auch durch Einschreiten als Außenstehende im Land selbst eingegriffen werden muss. Gewalt bringende Militäreinsätze können nie eine Lösung sein, aber Schutz bringende, auf den Einzelfall abgestimmte Maßnahmen, die das Schlimmste verhindern, sind nur logische Konsequenz der Vergangenheit. Kommt Deutschland dabei eine gesonderte Verantwortung beim Verhindern von Völkermorden zu? Wer die Vergangenheit kennt, wird schnell zu dieser Frage gelangen. Deutschland, dem Land, das den größten Genozid der Geschichte vollzogen hat? – Nein. Es wäre falsch zu denken, wir hätten eine besondere Verantwortung als Deutsche oder als Europäer. Im Gegenteil: Wir haben eine als Menschen. Hilfreich und erfolgreich ist ein Vorgehen gegen die Rohheit eines Genozids nur, wenn dahinter statt Institutionen Menschen stehen, die aus tiefer Überzeugung gewillt sind einzuschreiten. In Organisationen wie der UN kann sich in solchen Situationen der Wille der Masse widerspiegeln, aber ohne die Initiative der Zivilbevölkerung sind diese langfristig machtlos. Deshalb gilt es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass kein unmenschliches Vorgehen zu weit weg ist und kein Genozid nur in der Verantwortung anderer liegt.
Denn das Streben nach Frieden kennt keine Grenzen, keine Entfernungen, keine Verantwortungsbereiche. Vielmehr ist es der Wunsch nach Frieden, der uns alle verbindet, und zu dem sollten wir entschlossen stehen. Wenn wir wollen, ist der nämlich gar nicht so weit weg.
» Zurück zu den anderen Beiträgen des Essaywettbewerbs