Die Entwicklung der Schutzverantwortung
Souveränität als Verantwortung
Die Wurzeln der Schutzverantwortung reichen bis in die Mitte der 1980er Jahre zurück. Die Schutzverantwortung stellt daher keine Innovation im eigentlichen Sinne dar, sondern hat bereits vorhandene Elemente verknüpft und einen neuen, umfassenden Ansatz zum Schutz von Zivilisten entwickelt. Bereits 1987 hat Bernard Kouchner, Mitbegründer von Ärzte ohne Grenzen, die Ansicht vertreten, dass es ein „Recht zur Intervention“ gäbe, was international jedoch kritisch gesehen wurde. Bei derartigen Einsätzen mit humanitärer Intention hatte der Sicherheitsrat bis dato einzelfallbezogen über Legitimität und Umsetzung entschieden und eine Einmischung in interne Angelegenheiten von Staaten, auf Grund deren Souveränität zumeist abgelehnt. Souveränität, so der ehemalige australische Außenminister Gareth Evans, war und blieb für die Regierungen ihrer Länder eine „lincence to kill“.
In den 1990er Jahren erlebte die Diskussion um die Legitimität humanitärer Interventionen einen Höhepunkt. Nach den schockierenden Ereignissen in Ruanda 1994 und Srebrenica, sowie der umstrittenen Intervention im Kosovo 1999 hatte eine verstärkte Debatte über die Verhinderung von Massenverbrechen stattgefunden. Damit verbunden war ebenfalls eine Diskussion um die Neudefinition des Souveränitätsbegriffes und einer kollektiven Verantwortung zum Schutz von Menschenleben.
Hierbei ging es maßgeblich um zwei Aspekte: Zum einen betraf dies die Frage, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn der UN-Sicherheitsrat durch ein Veto blockiert ist, ein Eingreifen zum Schutz von Menschenleben jedoch gerechtfertigt scheint und eine (sub-)regionale Organisation zur Übernahme der Aufgabe bereit ist. Zum anderen ging es darum, wie besser verhindert werden kann, dass Staaten ihre Souveränität nicht länger dazu ausnutzen, solche Verbrechen durchzuführen oder zu dulden.
Mit dieser Problematik haben sich in den 90er Jahren unter anderem Francis Deng und Roberta Cohen beschäftigt und die Idee der „Souveränität als Verantwortung“ entwickelt. Diese kann als Vorgänger der Schutzverantwortung bezeichnet werden. Deng und Cohen reagierten damit auf das Paradoxon, dass für das Wohlergehen von Binnenvertriebenen und Flüchtlingen die jeweilige Regierung des Landes verantwortlich ist, die häufig eben jene Vertreibungen (mit-)verursacht hat. Souveränität sollte künftig nicht nur Recht, sondern auch Pflichten der Staaten gegenüber ihren Bevölkerungen mit sich bringen. Allerdings setzte das Konzept von Deng und Cohen eine Zustimmung des betreffenden Staates voraus, um Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Das Prinzip der Staatensouveränität wurde also weiterhin gewahrt. Zudem beschränkten sich die Folgen einer verweigerten Umsetzung der getroffenen Maßnahmen durch den Staat vor allem auf diplomatische Mittel.
International Commission on Intervention and State Sovereignity (ICISS)
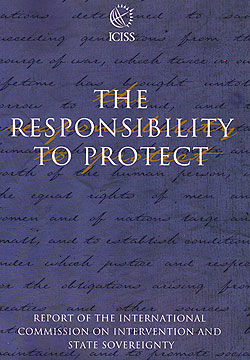
Der Bericht der International Commission on Intervention and State Sovereignty
Da auch dieses Konzept nicht den erhofften Erfolg hatte, richtete sich der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan nach der Kosovo-Intervention der NATO in der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1999 und durch seinen Millenniumsbericht im Jahr 2000 an die internationale Gemeinschaft und forderte diese auf, einen neuen Konsens zur Lösung des Dilemmas zwischen Intervention und Souveränität zu finden. Dieser Aufgabe nahm sich die Internationale Kommission zu Intervention und Staatensouveränität, die International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), im Jahr 2000 an.
Um eine breite Akzeptanz des Konzeptes zu sichern, wurde die ICISS bewusst so zusammengesetzt, dass die 12 Kommissionsmitglieder ein möglichst breites Spektrum an beruflichen wie regionalen Unterschieden repräsentieren. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass in den Co-Chairs ein Repräsentant für den Norden als auch für den Süden vertreten sein sollte. Die Wahl fiel auf Gareth Evans, ehemaliger australischer Außenminister und seit dem Jahr 2000 Chief Executive der angesehenen Denkfabrik International Crisis Group, sowie Mohamed Sahnoun ein algerischer Diplomat und ehemaliger Sonderberater des UN-Generalsekretärs für die Region der Großen Seen in Afrika. Auch bei der Auswahl der restlichen Mitglieder wurden auf verschiedene berufliche Hintergründe geachtet – von früheren Staats- und Regierungschefs, UN-Beamten, Generälen bis hin zu Journalisten und Wissenschaftlern. Insgesamt fanden fünf offizielle und ein informelles Treffen der Kommission statt, sowie verschiedene kleinere Treffen und Diskussionsrunden. Zwischen Januar 2001 und Juli 2001 wurden zudem elf regionale weltweite Diskussionstreffen sowie nationale Konsultationen geführt. Das Ergebnis war der im Jahr 2001 veröffentlichte Abschlussbericht „The Responsibility to Protect“.
Die Kommission ist bei der Entwicklung des Konzeptes von der Sichtweise der Opfer ausgegangen und nicht wie oftmals zuvor vom Standpunkt des intervenierenden Staates. Die Responsibility to Protect versteht die Staatensouveränität als Verantwortung des Staates zum Schutz seiner Bürger. Sollte der Staat unfähig oder unwillens sein, dieser Verantwortung nachzugehen, geht diese Schutzverantwortung auf die internationale Gemeinschaft über.
Das Konzept der Schutzverantwortung
Die Kommission definierte die Responsibility to Protect als auf drei Pfeilern basierend: Die Responsibility to Prevent (Verantwortung zur Prävention), Responsibility to React (Verantwortung zur Reaktion) und die Responsibility to Rebuild (Verantwortung zum Wiederaufbau). Die ICISS beschränkt den Anwendungsbereich der Schutzverantwortung auf die vier schwerwiegendsten Fälle von Menschenrechtsverletzungen: Völkermord, ethnische Säuberung, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Im ersten Pfeiler, der Verantwortung zur Prävention (Responsibility to Prevent), wird die Bedeutung von präventiven Maßnahmen und Frühwarnmechanismen hervorgehoben. Dieser Pfeiler wird von der Kommission selbst als der wichtigste der drei Pfeiler beschrieben. Hier werden verschiedene politische, diplomatische, wirtschaftliche oder rechtliche Maßnahmen zur direkten Prävention der vier genannten Menschenrechtsverletzungen aufgeführt. Die Kommission betont, dass sämtliche Präventionsmaßnahmen genutzt werden sollten. Hierunter fallen beispielsweise Entwicklungszusammenarbeit sowie Programme mit dem Ziel, die Konfliktursachen zu bekämpfen und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu fördern. Aber auch die Verbesserung von Handelsbeziehungen sowie die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofs werden beispielhaft erwähnt.
Der zweite Pfeiler des Konzepts der Schutzverantwortung, die Verantwortung zur Reaktion (responsibility to react), betont, dass alle präventiven und diplomatischen Instrumente (zu denen politische, wirtschaftliche oder militärische Sanktionen gehören) erschöpft sein müssen, bevor eine militärische Intervention in Betracht gezogen wird. Als Beispiele werden in diesem Zusammenhang fragile oder zerfallene Staaten genannt, in denen jegliche Ordnung zusammengebrochen ist oder Situationen, in denen interne Konflikte bzw. Repressionen so gewalttätig verlaufen, dass das Risiko besteht, dass Zivilisten Opfer von Massenverbrechen werden. Sollten präventive Maßnahmen versagt haben und eine Intervention unumgänglich sein, ist diese an verschiedene Voraussetzungen gebunden: Ein gerechter Grund (just cause), die richtige Absicht (right intention), das letzte Mittel (last resort), die Verhältnismäßigkeit des Mittels (proportional means), vernünftige Erfolgsaussichten (reasonable prospects) und die zuständige Autorität (right authority).
Der dritte Pfeiler des Konzeptes der Responsibility to Protect, die Verantwortung zum Wiederaufbau (Responsibility to Rebuild), beinhaltet unter anderem die Aufrechterhaltung der Sicherheit durch Maßnahmen wie Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration, Gerechtigkeit und Versöhnung sowie Entwicklung durch wirtschaftliche Maßnahmen. Sie ist die am wenigsten ausgearbeitete und diskutierte Maßnahme, findet sich jedoch praktisch in der Arbeit von Blauhelm Friedensmissionen der UN oder regionaler Organisationen wieder.
« Zurück zum Portal Schutzverantwortung – Responsibility to Protect






