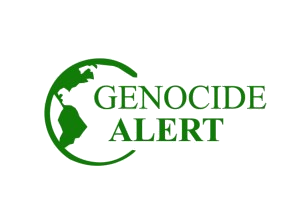von Haid Haid
Haid Haid ist syrischer Sozialwissenschaftler und hat Damaskus im Januar 2012 verlassen. Er arbeitet als Programm-Manager beim Middle East Office der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut.
(aus dem Englischen von Christoph Schlimpert)
Die syrische Revolution dauert bereits mehr als 15 Monate an, die durchschnittliche Anzahl der pro Tag getöteten syrischer Zivilisten und Kombattanten (sowohl auf Seiten der Gegner als auch der Befürworter des Regimes) steigt stetig. Dennoch sind viele nach wie vor nicht in der Lage sich zu einigen, wie auf die Krise reagiert werden soll. Die internationale Gemeinschaft bleibt machtlos darin, dem Abschlachten ein Ende zu setzten. Die Komplexität der Lage in Syrien trägt dazu bei, dass die internationale Gemeinschaft sich bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen und der Hilfe zum Schutze der syrischen Bevölkerung zurückhält.
Um die Positionen der internationalen Gemeinschaft angemessen zu verstehen, ist eine kurze Bestandsaufnahme der Maßnahmen erforderlich, welche diese gegen das syrische Regime ergriffen hat. Diese Maßnahmen und Sanktionen sollten aus der Perspektive des regionalen geopolitischen Machtgleichgewichts betrachtet werden, um klar zu versehen, warum die internationale Gemeinschaft so zögerlich ist.
1. Regionale Interventionen in der Syrischen Revolution
Die kategorische Weigerung des Assad-Regimes Macht abzugeben, zusammen mit seiner Unfähigkeit, ohne äußere Hilfe sein eigenes Überleben zu sichern, führte zu seinem Drängen auf eine „freundliche“ Intervention der russisch-chinesisch-iranischen Achse. Im Gegenzug fand sich die US-europäische Achse, mit der Türkei und einigen arabischen Staaten zusammen. Jedoch fehlt ist diese weitaus weniger koordiniert als die pro-Assad Achse.
Ungeachtet wiederholter Versuche der arabischen, regionalen und internationalen Gemeinschaften, Initiativen darzulegen, welche dem Regime helfen würden die Krise zu überwinden, wurde schnell klar, dass Assad nicht die Absicht hatte, eine Lösung zuzulassen, welche von außerhalb Syriens käme. Syrien wurde zu einem Schlachtfeld, einem Ort, an welchem internationale und regionale Rechnungen beglichen werden. Dies steigerte wiederum die Komplexität der politischen Situation des Landes: nicht mehr nur eine Auseinandersetzung zwischen einem repressiven Regime und einer revolutionären Bevölkerung, nahm der Konflikt eine darüber hinausgehende regionale und internationale Dimension an.
Der Mehrheit der Syrer wurde unterdessen klar, dass eine Entscheidung im Kampf um Syrien (ein Kampf, der bis dato auf das Gebiet innerhalb der syrischen Grenzen beschränkt war) einen internationalen und regionalen Konsens erforderte. Die Unterstützung der Revolution war nicht mehr nur einfach eine Angelegenheit, in der es darum ging, ein Volk im Kampf um ihre Grundrechte zu unterstützen, sondern auch ein Vorwand, um in eine umfassendere Auseinandersetzung um Einfluss in der Region eingreifen zu können.
Manche westlichen und arabischen Staaten sehen die Vorgänge in Syrien als Gelegenheit, Syriens Verbündete, Russland und Iran, zu marginalisieren. Mit anderen Worten handelt es sich um einen Stellvertreterkrieg gegen den Iran, Saudi Arabiens regionalen Gegner. Russland und China zeigten sich unterdessen höhst erfolgreich darin, die Bemühungen der USA und ihrer europäischen und arabischen Partner um eine UN-Sicherheitsratsresolution zu vereiteln, welche diesen einen weiteren Stand im Nahen Osten verschaffen und die westliche Militärpräsenz im mediterranen Raum verstärken würde. Irans uneingeschränkte Unterstützung für das syrische Regime, beispielhaft erläutert durch die Aussage des iranischen Staatsoberhauptes, Ayatollah Khamenei, dass sein Land seinen regionalen Verbündeten um jeden Preisverteidigen würde, kann am besten verstanden werden, wenn man die Konsequenzen eines Sturzes von Assad prüft: Es würde bedeuten, dass Iran einen seiner wichtigsten strategischer Verbündeten in der Region verlieren würde.
Viele Syrer glauben, dass, während das Überleben der Revolution in den Händen der Syrer selbst liegt, der Sturz Assads vom regionalen und internationalen Konsens abhängt. Es ist die Aufgabe der Syrer, die Flamme der Revolution durch friedliche Demonstrationen am Leben zu halten, bis eine Übereinkunft erreicht werden kann.
2. Arabische und internationale Sanktionen
Aufgrund dessen, dass das syrischen Regimes an der exzessiven Gewaltanwendung gegenüber seiner Bevölkerung festhält und im Lichte des Unwillens der internationalen Gemeinschaft, eine militärische zu intervenieren, verhängten die USA, die EU und die Arabische Liga weitreichende Sanktionen. Diese beinhalteten Reisebeschränkungen für die Assad-Familie und syrische Offizielle, das Einfrieren ihrer Bankkonten und –vermögen, ein Embargo gegenüber dem Kauf syrischen Öls und die Schwächung der syrischen Cyber-Fähigkeiten. Die EU hat vor kurzem eine Liste von 14 Produkten aufgestellt, welche nicht an Syrien verkauft werden dürften. Diese schließt Luxusgüter ein und Informationstechnologie, welche für die interne Repression geeignet ist. Ebenso wurde das Land teilweise diplomatisch isoliert..
Es soll erwähnt sein, dass diese Sanktionen nicht die volle Unterstützung der syrischen Opposition fanden. Diejenigen, welche an der Notwendigkeit von Sanktionen und ihrer Effektivität zweifeln, behaupten, diese schadeten der Revolution selbst. Das Regime kann sich um sich selbst kümmern. Es hat eine langjährige Erfahrung mit Schmugglernetzwerken, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sowohl der Libanon als auch der Irak gegen die arabischen Sanktionen gestimmt hatten, während Jordanien sich enthielt. Auf internationaler Ebene fahren Russland, China und der Iran damit fort, dem Regime materielle, technologische und militärische Unterstützung zukommen zu lassen. (1)
Für Befürworter von Sanktionen bleibt währenddessen zu hoffen, dass die Maßnahmen doch in der Lage sein werden, das Regime in den Schwitzkasten zu nehmen, was dazu führen würde, dass es seine anti-revolutionären Operationen nicht mehr finanzieren könnte, während syrische Geschäftsleute dazu gedrängt würden, ihre Unterstützung für das Regime aufzugeben.
Obwohl es aufgrund der Informationssperre des Regimes nahezu keine Wirtschaftdaten gibt, gibt es einige Hinweise, die uns einen Eindruck davon geben, wie schwierig die Lage und wie tief die Krise in Syrien ist. Am offensichtlichsten und wohl am bedeutendsten sind die Zahlen des Internationalen Währungsfonds. Sie zeigen, dass das Syrische Pfund seit Ausbruch der Revolution auf 45% des Wertes bei Ausbruch der Revolution gefallen ist. (2) Große Summen wurden von privaten Bankkonten abgezogen und die Kosten der Güter des täglichen Bedarfs haben nie dagewesene Höhen erreicht. Es ist klar, dass sich Syrien mittlerweile gravierenden ökonomischen Problemen ausgesetzt sieht.
Dennoch sollten wir im Kopf behalten, dass viele Syrer wirtschaftliche Sanktionen an sich als unwirksam darin betrachten, das Regime zu Zugeständnissen zu zwingen oder gar seinen Sturz herbeizuführen. Um eine Lösung der Krise zu erreichen, müssen diese Sanktionen mit ernsthaftem internationalem Druck einhergehen.
3. Die Responsibility to Protect
Die gegenwärtige Krise in Syrien ist ein perfektes Fallbeispiel dafür, wie das Prinzip der Schutzverantwortung (Responsibility to Protect; R2P) für die Rechtfertigung internationaler Intervention gebraucht werden könnte.(3)
Das syrische Regime, welches fortlaufend Gewaltakte gegen seine schutzlose und isolierte Zivilbevölkerung ausführt, hat seine Pflicht zum Schutze seiner Bürger grundliegend ignoriert. Zwischen dem Ausbruch der Revolution im März 2011 und dem 12. Mai 2012 haben syrische Sicherheitskräfte mindestens 12.782 Personen getötet und weitere 24.319 festgenommen (Zahlen des Centre for the Documentation of Human Rights Violations in Syria (4). Regierungstruppen beschossen dicht bevölkerte Wohngebiete mit Artilleriefeuer, setzten Scharfschützen und Kampfhubschrauber gegenüber Zivilisten ein und folterten verwundete Demonstranten in Krankenhäusern.
Diese Übergriffe sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, definiert durch das Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Das syrische Regime hat darin versagt, seine Pflicht zum Schutze seiner Zivilbevölkerung wahrzunehmen, weshalb diese Verantwortung nun an die internationale Gemeinschaft übergeht.(5)
Die internationale Gemeinschaft zögert jedoch aus folgenden Gründen nach wie vor, ihre Verantwortung zu akzeptieren:
- Sorge über die post-revolutionäre Regierungsform. Dies schließt die Angst vor potentieller innerer und regionaler Instabilität mit ein, sowie dass die neue Regierung von Islamisten dominiert sein könnte, wie es in anderen post-revolutionären arabischen Staaten geschehen ist. Dies wird durch die internen Auseinandersetzungen innerhalb der syrischen Opposition verschärft, welche sie davon abhalten, einen „Fahrplan“ auszuarbeiten, welcher die internationale Gemeinschaft und jene Syrer beruhigen würde, die aus Furcht vor einer unsicheren Zukunft der Revolution nicht ihre Unterstützung ausgesprochen haben.
- Erfahrungen mit militärischen Interventionen in anderen Ländern in der Vergangenheit: Die anhaltende Instabilität in Libyen und die Unfähigkeit des libyschen Staates, seine Autorität durchzusetzen und die Bevölkerung zu entwaffnen. Das libysche Modell dient als wirkungsvolle Abschreckung gegenüber jeder Form einer direkten militärischen Intervention, besonders für viele in Europa.
- Zweifel an der Effektivität einer indirekten militärischen Intervention (6), angesichts des Umstands, dass die Opposition über keine zentralisierte militärische Streitkraft verfügt. Es gibt ebenfalls Sorgen über die Konsequenzen einer Bewaffnung extremistischer islamistischer Gruppen, die jüngst in Syrien aufgetaucht sind.
- Eine Präferenz für eine Transition gegenüber einem Umsturz durch einen Entscheidungsschlag: Ein gradueller Prozess würde anderen Staaten Zeit geben, um ihre Interessen in der Region anzupassen und zu beschützen.
- Israelische Interessen und Israels Einfluss auf die amerikanischen Interessen. Aus israelischer Perspektive ist die Priorität nicht, Menschen zu schützen, sondern vielmehr, die Auswirkungen eines Regimewechsels auf die israelische Sicherheit zu minimieren.
- Innenpolitische Bedenken: Der amerikanische Unwille, bei den Forderungen nach einem Ende der Gewalt die Führung zu übernehmen, liegt in großen Teilen in den anstehenden Präsidentschaftswahlen begründet. Obama strebt nach einer zweiten Amtszeit und kann keine Komplikationen durch eine Ausdehnung amerikanischen Engagements auf Syrien gebrauchen.
- Wirtschaftliche Gründe: Die Wirtschaftskrise in der EU und den USA und ihr Einfluss auf die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, die Rechnung für eine militärische Intervention in Syrien zu zahlen.
- Alleiniger Fokus auf eine militärische Intervention: Der Fokus der syrischen Opposition und der internationalen Gemeinschaft auf eine militärische Intervention, welche in der gegenwärtigen Situation nicht wünschenswert ist, hält sie davon ab, andere Formen der Einflussnahme auszuloten.
Auch wenn dies alles richtig ist, entschuldigt es nicht den Widerwillen der internationalen Gemeinschaft, ihre Verantwortung gegenüber dem syrischen Volk wahrzunehmen. Die internationale Gemeinschaft ist mehr als fähig, ihre Vorbehalte zu überwinden, wenn sie eine echte Gefährdung ihrer eigenen Sicherheit oder Interessen empfindet. In Libyen beispielsweise traf die internationale Gemeinschaft die Entscheidung, militärisch zu intervenieren, vergleichsweise schnell, ungeachtet der Einwände von Russland und China. Jedoch scheint sie unfähig zu sein, eine UN-Sicherheitsratsresolution zu verabschieden. Dies liegt daran, dass diese eine direkte Bedrohung der Interessen bestimmter Staaten darstellt, während sie für andere eine Gelegenheit bieten würde.
4. Die syrische Revolution
Die internationale Gemeinschaft neigt dazu, ihr Versagen zu rechtfertigen, indem sie auf darauf verweist, dass die Opposition nicht geeint ist, es an einer machbaren politischen Alternative zum Assad-Regime fehlt und sich auf das russische und chinesische Veto im UN-Sicherheitsrat beruft. Die Debatte über die Syrienkrise wird stets durch solche Details überlagert, obwohl sie eigentlich auf das ausgerichtet sein sollte, was die syrische Bevölkerung erlebt, welche tagtäglich dem Tod ins Auge blickt, weil sie grundlegende Freiheitsrechte, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einfordert.
Obwohl das das Wesentliche in dieser Angelegenheit sein sollte, ignorieren internationale Akteure dies meist. Sie konzentrieren sich lieber auf ihre Ängste, was zumeist den Vergleich von Syrien mit anderen arabischen Staaten wie Libyen und Irak einschließt. Sie äußern sich besorgt über die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs und üben sich in Kassandrarufen und Analysen, welche zumeist auf ignorieren, was sich bereits jetzt in Syrien ereignet. Diese Ängste werden weiter gesteigert durch die zunehmende Tendenz westlicher und arabischer Medien, die Revolution als sektiererisch und salafistisch zu porträtieren.
Dennoch resultieren diese politischen Komplexitäten und besorgniserregenden Vorhersagen über die Zukunft des Landes größtenteils aus zunehmenden repressiven Aktionen und exzessiven Gewaltanwendung des Regimes sowie zum anderen aus dem Unwillens der internationalen Gemeinschaft, die Revolution und ihre legitimen Forderungen zu unterstützen. Selbstverständlich hat auch die traditionelle syrische Opposition ebenfalls einige Verantwortung zu tragen, denn zeigt sich sich der Lage nicht gewachsen . Es wäre an ihrer Stelle notwendig, sich zu vereinen, um den internationalen Bemühungen dem syrischen Volk zu helfen einen klaren Anknüpfpunkt zu bieten. Sie ist darin gescheitert, einen überzeugenden Diskurs oder eine klare Marschoroute für eine post-Assad Machtverteilung herzustellen.
Die anhaltende Gewalt des Regimes gegen die eigene Bevölkerung und die Schwäche und Reformunfähigkeit der traditionellen Opposition führten dazu, dass sich viele Syrer isoliert und von der arabischen und internationalen Gemeinschaft ihrem Schicksal überlassen fühlen.(7)
Dies führt zwangsläufig dazu, dass manche Syrier sich dafür entscheiden, Waffen gegen das Regime zu richten. Dennoch glauben die Syrer nach wie vor, dass Waffen alleine nicht Assads Sturz bringen werden und führen ihre gewaltfreien Demonstrationen fort.
Die Islamisierung der Revolution kann man indes am besten als eine Phase begreifen. Die große Mehrheit der Syrer sind sunnitische Muslime, deren Religiosität konventionell, traditionell und apolitisch ist. Mit anderen Worten: moderat, aufgeschlossen und tolerant gegenüber ethnischer, religiöser und konfessioneller Diversität. Konfessionelle Vielfältigkeit war bereits seit Jahrhunderten ein Teil Syriens und blieb auch von politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Wandel unberührt. Im Gegensatz zu seinen eigenen Bekundungen, ist Assad nicht der Schutzherr der Minderheiten; viel eher ist dies das syrische Volk selbst.
Die dschihadistisch-salafistische Bewegung, welche im Zuge der US-Besatzung des Iraks ans Licht getreten ist, ist größtenteils selbst ein Produkt des Assad Regimes. Die Sicherheitskräfte haben diese Gruppierungen durchdrungen und benutzen sie, um Druck auf die US-Besatzung, oder, nach dem syrischen Rückzug aus dem Libanon, im palästinischen Flüchtlingslager Nahr al-Bared auszuüben. Es ist bezeichnend, dass vor Ayman al-Zawaheris Unterstützungserklärung für die syrische Revolution keine dschihadistische Organisation, einschließlich Al-Qaida, verkündet hatte, dass sie Operationen gegen das syrische Regime durchführen würde, noch dieses verurteilt hätte.
Ungeachtet des Wachstums von Gruppierungen wie al-Ansar und al-Nour (8), besteht die echte Gefahr nicht darin, dass der Salafismus sich in einem post-revolutionären Syrien durchsetzt (es ist wahrscheinlicher, dass die dschihadistische Bewegung nach dem Fall des Regimes, das sie aufgezogen und versorgt hat in der Unbedeutendheit verschwindet). Viel gefährlicher in dieser Hinsicht ist, dass die Revolution scheitern könnte, bzw. dass sich die gegenwärtige Situation ohne Aussicht auf ein Ende der Gewalt fortsetzt. Der Grund hierfür ist, dass diese extremistischen Gruppen mit der Zeit an Stärke gewinnen. Zeit erlaubt ihnen, sich auszubreiten und die Gesellschaft zu durchdringen. Um die friedliche Natur der Revolution zu bewahren und die Zukunft des Landes und der Region zu sichern, muss die Krise so schnell wie möglich gelöst werden.
Die Unentschlossenheit der westlichen Mächte aufgrund ihrer Angst, dass salafistische und islamistische Dschihadisten in Syrien an Boden gewinnen, hat sie davon abgehalten, die Revolution tiefergehend zu unterstützen. Jedoch ist es ironischerweise genau diese Unentschlossenheit, die die idealen Bedingungen für einen dschihadistisch geprägten Aufstand hervorbringt. Dschihadisten füllen die Lücke, welche durch den Mangel an internationaler Aktion gegenüber der anhaltenden brutalen Gewalt des Regimes entstanden ist.
5. Fazit
Jede Betrachtung der syrischen Revolution muss sich zuallererst darauf richten, was in Syrien tatsächlich passiert: ein Volk verlangt die grundlegenden Rechte auf Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung gegenüber einem Regime, welches entschlossen ist, sich an die Macht zu klammern, koste es was es wolle; ein Volk welches vor einem Regime geschützt werden muss, das jegliche Verantwortung fallen gelassen hat und entschlossen ist, seine Bevölkerung mit allen ihm zur Verfügung stehenden barbarischen Mitteln zu unterdrücken.
Pflicht und Moral gebieten, dass die arabische und die internationale Gemeinschaft unverzüglich und effektiv unter dem Prinzip der Schutzverantwortung eingreifen, um die Gewalt zu stoppen. Ebenso haben sie ein reales Interesse an einer schnellen Lösung der Krise. Die exzessive Gewaltanwendung während gleichzeitig eine umsetzbare politischen Lösung fehlt, und das Gefühl der Menschen, dass sie beim Kampf gegen eine staatsgestützte Mordmaschine auf sich allein gestellt sind, kreiert die perfekte Umgebung für die Ausbreitung einer gewalttätigen Gegenbewegung, deren Auswirkungen auch außerhalb der Grenzen Syriens zu spüren sein werden. Die Situation im Libanon ist hierfür eine ernüchternde Mahnung.
Es ist folglich angemessen darauf hinzuweisen, dass das Versagen der internationalen und regionalen Mächte dem syrischen Volk bedeutsame Unterstützung zukommen zu lassen, vom Widerwillen herrührt, irgendeine Form militärischer Intervention, direkt oder indirekt, auf die Beine zu stellen. Die internationale Gemeinschaft versteht nicht, dass eine militärische Intervention nicht die einzige Lösung ist und versäumt deshalb andere Wege, wie eine z.B., den s Fall an den Internationalen Strafgerichtshof zu überweisen, zu erkunden.
Unten angeführt sind einige alternative Optionen die den internationalen Akteuren zur Verfügung stehen:
- Druck auf das Regime und seine Alliierten ausüben, damit dieses den Kofi-Annan-Plan vollständig implementiert.
- Das syrische Regime hat sich bislang aufgrund seiner regionalen Alliierten in halten können. Die internationale Gemeinschaft kann dabei helfen, die Krise zu lösen, in dem es regionale Bündnisse mit dem Regime kappt und Druck auf Russland, China und Iran ausübt, die Lieferung von militärischer, materieller und technologischer Hilfe einzustellen, welche es Assad ermöglicht, seinen Krieg gegen die Bevölkerung durchzuführen.
- Druck auf Nachbarstaaten (Irak, Libanon und Jordanien) ausüben, damit diese sich den Sanktionen anschließen, um so deren Effektivität zu steigern und die Lebensdauer des Regimes zu verkürzen.
- Internationale und arabische Akteure dazu zu ermutigen, zusammenzuarbeiten, um die vollständige politische Isolation des Regimes sicherzustellen.
- Daran zu arbeiten, die Anzahl der internationalen Beobachter und Peacekeeper zu erhöhen, um der Gewalt ein Ende zu bereiten und das Recht der Syrer zu schützen, sich an friedlichen Demonstrationen zum Sturze des Regimes zu beteiligen. (9)
- Druck auf die traditionelle politische Opposition und ihre regionalen Unterstützer ausüben, endlich zusammenzuarbeiten und eine klare Vision für ein post-Assad Syrien zu entwerfen. Diese muss einen Plan mit praktischen Schritten enthalten, um Syriens Wandel hin zu einem existenzfähigen zivilen und demokratischen Staat, der die Rechte und Freiheiten all seiner Bürger schützt zu garantieren. Dies wird denjenigen Sicherheit geben, die Zweifel an den Zielen der Revolution hegen und die über die Lebensperspektiven nach Assad beunruhigt sind.
- Alle legitimen Mittel anwenden die zur Verfügung stehen, um den Syrern zu helfen, das Regime selbst zu stürzen.
- Die syrischen Flüchtlinge im Ausland unterstützen und sicherstellen, dass ihnen ein würdiges Leben und die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse zuteilwird. Diese Flüchtlinge vor Zwangsrückführung zu schützen, was in der derzeitigen Lage ihr Leben in Gefahr bringen könnte.
- Der Opposition helfen eine militärische Organisation aufzubauen, um so den Einfluss extremistischer Gruppen zu reduzieren, für welche das gegenwärtige Syrien eine ideale Umgebung darstellt. Die internationale Gemeinschaft sollte die „Freie Syrische Armee“ anerkennen und sie darin unterstützen, sich politisch und intellektuell zu organisieren, die Prinzipien der Selbstverteidigung und Bürgerverteidigung, für welche diese ursprünglich geschaffen wurde, zu klären und sie so hoffentlich in ein Bollwerk gegen die zunehmend einflussreichen salafistischen Kampfgruppen transformieren.
- Den Aufbau syrischer, arabischer und internationaler “Wahrheits- und Versöhnungskommissionen“ mit der Aufgabe, Beweise für die Verurteilung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sammeln. Die Täter müssen das Gefühl bekommen, dass sie die Konsequenzen für ihre Handlungen tragen werden müssen: nichts anderes wird sie davon überzeugen, davon abzulassen.
- Staaten, welche zu den Unterstützern von Sanktionen gegen das Regime zählen, müssen einen klaren Fahrplan entwerfen, wie nach dem Fall des Regimes diese Strafmaßnahmen wieder aufgehoben und die syrische Wirtschaft zu ihrer vollen Stärke zurückkehren kann. Dies würde den syrischen Geschäftsleuten, welche gegenwärtig das Regime stützen, versichern, dass die syrische Wirtschaft nicht den Weg der Volkswirtschaften in Irak und Libanon gehen wird, und dass das Ende des Regimes auch in ihrem Interesse ist.
__________________________________________________________
(1) “The Financial Times: Iran helps Syria to overcome oil sanctions.” BBC Arabic Website, 18. Mai 2012
(2) Ibrahim Seif, “Syrian economy on the brink.” 22. Mai, 2012. Carnegie Endowment for International Peace
(3) Die Schutzverantwortung ist ein Prinzip, welches die UN-Generalversammlung 2005 im Kontext der Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien, Ruanda, Kongo, Somalia, Kosovo und andernorts, angenommen hat. Es verknüpft die Souveränität eines Staates mit dessen Verantwortung zum Schutze der eigenen Bevölkerung.
(4) Center for documentation of violations in Syria
(5) Falls ein Staat eindeutig darin versagt, seine Bürger zu schützen, geht die Verantwortung auf die internationale Gemeinschaft über, zeitnah und entschlossen mit friedlichen oder militärischen Mitteln nach Kapitel 6, 7 und 8 der Charta der Vereinten Nationen zu reagieren. Dies beinhaltet Sanktionen, die Überweisung an den Internationalen Strafgerichtshof und eine militärische Intervention.
(6) D.h. militärische und technische Unterstützung der bewaffneten Opposition.
(7) Der Slogan “Ya Allah, ma ilna ghayrak, ya Allah” (Oh Gott, wir haben niemanden außer Dir, oh Gott) der im Sommer 2011, wenige Monate nach Beginn der Revolution auftauchte, deutet auf das zunehmende Gefühl vieler Syrier von einer tiefen Isolation und fehlender Unterstützung hin.
(8) Beides sind Gruppierungen bewaffneter islamistischen Dschihadisten, welche von sich behaupten, in Syrien zu operieren.
(9) Wie zum Beispiel streiken zu können, ohne dass die Sicherheitstruppen oder die shabiha in Geschäfte einbrechen und diese plündern.