Der Sudan befindet sich nach der Absetzung von Omar al-Bashir am 11. April 2019 in einem grundlegenden Umbruch. Al-Bashir, der vom International Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in Darfur gesucht wird, war einer der am längsten herrschenden Führer Afrikas. Sein Sturz wurde durch eine anhaltende und vor allem friedliche Kampagne einer vielfältigen und überraschen d gut organisierten Protestbewegung ausgelöst. Ein friedlicher Übergang zu einer inklusiveren, zivil geführten und mittelfristig auch demokratisch legitimierten Führung schien gelingen zu können. Doch im Juni wurde dieser Übergangsprozess zunächst gewaltsam gestoppt – über 100 Menschen wurden von einer Regierungsmiliz getötet, dutzende vergewaltigt, hunderte verletzt. Die Anfang Juli erzielte Einigung zwischen der Militärjunta und der Oppositionsbewegung schafft neue Hoffnung, ist aber auch mit Risiken behaftet. Teile des zersplitterten Sicherheitsapparats scheinen wenig Interesse an wirklichen Veränderungen zu haben und viele Oppositionelle misstrauen den Militärs.
Beitrag von Gregor Hofmann
Die Proteste und der Sturz Omar al-Bashirs
Im Dezember 2018 gingen hunderte Menschen im Zentrum von Atbara auf die Straße. Sie protestierten gegen die Verdreifachung der Brotpreise durch die Regierung und gegen die schlechte wirtschaftliche Lage: Im Land herrscht schon seit langem eine Wirtschaftskrise, die Inflation ist hoch. Die Proteste breiteten sich auf Khartum und andere Städte aus, Demonstrantinnen und Demonstranten forderten Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit.
Im Laufe der Proteste kam es immer wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei, Verhaftungen und die Verhängung martialischer Strafen durch Sondergerichte. Die Demonstrationen gingen jedoch weiter. Im Januar 2019 schlossen sich verschiedene Oppositions-, Protest- und auch Rebellen-Gruppen zur Alliance for Freedom and Change zusammen und veröffentlichten die Declaration of Freedom and Change, in der der Rücktritt Bashirs und des Regimes und eine Demokratisierung des Landes unter einer zivilen Regierung gefordert wurde.
Letztendlich führten die anhaltenden Proteste zum Sturz von Omar al-Bashir: Einige Tage nachdem in Algerien der langjährige Präsident Abdelaziz Bouteflika von Demonstranten zum Abtritt gezwungen wurde, rief die Sudanese Professionals Association, ein Dachverband verschiedener inoffizieller Berufsverbände und Gewerkschaften, zu einem Marsch auf das Militärhauptquartier in Khartum auf. Am 6. April 2019 demonstrierten dann Hundertausende in der Hauptstadt und forderten die Militärangehörigen auf, sich ihnen anzuschließen. An den Protesten waren Vertreter nahezu aller Volksgruppen, jeden Alters, aller Klassen und Geschlechter beteiligt. Daraus entwickelt sich ein ausgedehntes Sit-In: Ein Lager wurde vor dem Militärhauptquartier errichtet. Die Menschen suchten immer kreativere Ausdruckformen für ihren Protest und versorgten sich gegenseitig mit dem Notwendigsten.
Die Polizei versuchte, die Demonstrierenden mit Tränengas und Schüssen aufzuhalten. Teile des Militärs, vor allem niedrigere Ränge, stellten sich jedoch auf Seiten der Protestbewegung und verteidigten sie. Am 11. April schließlich, am sechsten Tag des Protestamps, wurde al-Bashir gestürzt und vom Militär unter Hausarrest gestellt. Staatliche Medien kündigen an, dass alle verhafteten Protestierenden freigelassen werden. Ein Übergangs-Militärrat, der Transitional Military Council, verkündet eine zweijährige Übergangsphase unter Führung des Militärs, nahm auf öffentlichem Druck hin jedoch kurz darauf auch Verhandlungen mit der Protestbewegung auf. Diese wurden allerdings immer wieder unterbrochen.
Mitte Mai 2019 schienen sich der Übergangsmilitärrat und die oppositionelle Alliance for Freedom and Change auf einen Übergangsplan geeinigt zu haben: Nach einer dreijährigen Übergangsphase unter einem mit Militärs und Zivilisten besetzten Rat, sollten freie Wahlen abgehalten werden.
Das Massaker vom 3. Juni
Was danach geschah, ist nicht ganz klar. Nach verschiedenen Berichten waren Teile des Militärrates mit dem vorläufigen Deal unzufrieden, da sie befürchteten, zu viel Macht abtreten zu müssen. Dies galt insbesondere für die sogenannten Rapid Support Forces (RSF) und ihren Anführer, Mohamed Hamdan Dagalo („Hemedti „).
Hemedti ist offiziell der stellvertretende Vorsitzende des Übergangsmilitär-Rates, dem Abdel Fattah al-Burhan, der Inspektor der Streitkräfte, vorsteht. Für viele gilt Hemedti aber de facto als der eigentliche starke Mann. Hemedtis Rapid Support Forces sind eine paramilitärische Einheit, die hauptsächlich gegen Aufständische eingesetzt wird und vor allem aus ehemaligen Mitgliedern der Janjaweed-Miliz besteht, denen bereits während des Darfur-Konflikts schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden. In den letzten Jahren hatte Bashir die RSF stark unterstützt, um andere Elemente des Sicherheitsapparates auszubalancieren. Die RSF gewann auch an Einfluss, da sie die Goldproduktion im Norden der sudanesischen Region Darfur kontrollieren. Außerdem sind sie in die Grenzsicherung eingebunden und haben Kämpfer in den Jemen entsandt, die dort für Saudi Arabien kämpfen.
Spannungen zwischen Sicherheitskräften – insbesondere der RSF – und den Protestierenden waren immer präsent. Am 3. Juni aber verübte die RSF ein Massaker bei der Räumung des seit nunmehr zwei Monaten existierenden Protestcamps vor dem Militärhauptquartier: Über hundert Menschen wurden getötet, mindestens 70 vergewaltigt und Hunderte verletzt. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Auch Zelte, in denen Protestierende schliefen, wurden angezündet. Die Sicherheitskräfte schossen sogar in medizinischen Einrichtungen auf Protestierende. Leichen wurden anschließend im Nil entsorgt, um das Ausmaß zu verdecken. Das Vorgehen erinnerte an das frühere Vorgehen der Janjaweed gegen vermeintliche Rebellendörfer in Darfur.
Ziviler Ungehorsam als Reaktion auf die Gewalt
Das brutale Vorgehen hatte nicht die gewünschte Wirkung: Die Protestbewegung fühlte sich an die Niederschlagung der Proteste in Ägypten nach dem Sturz Mursis im Jahr 2013 erinnert und wollte verhindern, dass dem Sudan ähnliches wiederfährt. So kam es statt zu einem Abflammen der Proteste zu einem mehrtägigen Generalstreik ab dem 9. Juni und einer landesweiten Kampagne zivilen Ungehorsams.
Dieser Druck und anhaltende Proteste zeigten Wirkung: Nach verschiedenen Mediationsversuchen durch Äthiopien und die Afrikanische Union im Laufe des Junis, zeigte sich der Militär-Übergangsrat verhandlungsbereit und begann damit, festgenommene Protestierende freizulassen.
Am Donnerstag, dem 4. Juli 2019, einigten sich das Militär und die Alliance for Freedom and Change schließlich auf eine von der Afrikanischen Union und Äthiopien vermittelte Übergangslösung: Nach eine dreijährigen Übergangszeit sollen Wahlen abgehalten werden. Bis dahin soll ein „Oberster Rat“ das Land führen. Er soll auf jeweils fünf Zivilisten und fünf Militärs sowie einem Vorsitzenden bestehen. Der Vorsitz wechselt zwischen beiden Seiten. Mitte Juli wurde ein erster Teil eines Abkommens unterzeichnet: In den ersten 21 Monaten soll dem Obersten Rat ein Militärvertreter vorstehen, in den folgenden 18 Monaten dann ein Mitglied der Alliance for Freedom and Change. Außerdem soll eine Expertenregierung gebildet werden. Das Militär versprach zudem umfangreiche und unabhängige Untersuchungen der Gewalt gegen Zivilisten – wogegen es sich bislang gesträubt hatte.
Aber viele umstrittene Punkte sind noch nicht geklärt, darunter die Frage, wieviel gesetzgeberischer Einfluss und Exekutivgewalt dem Militär zukommen soll sowie ob Militärangehörigen Immunität von der Strafverfolgung wegen der Ermordung von Demonstranten gewährt werden soll. Rebellengruppen aus Darfur, Blue Nile und Südk-Kordofan sind skeptisch gegenüber dem Übereinkommen, da sie seit Jahren mit dem Militär und insbesondere den RSF in bewaffnetem Konflikt stehen und die sudanesischen Sicherheitskräfte bislang wenig Rücksicht auf die Bevölkerung genommen haben. Auch andere Teile der Oppositionsbewegung beklagen zu viele Zugeständnisse an die Militärs.
Weiterer Übergang mit großen Risiken behaftet
Doch Kommentatoren argwöhnen unter Verweis auf die im Mai erzielte Einigung und das darauf folgende gewaltsame Vorgehen der RSF gegen die Protestierenden Anfang Juni, dass Stabilität und ein sicherer Weg in Richtung Demokratie und einer zivilen Regierung keineswegs garantiert seien. Da der Führer der RSF, Hemedti, weiterhin als die wahre Machtperson im Militärrat gesehen wird, sind Zweifel angebracht, ob es letztendlich wirklich zu einer Aufklärung der Gewalt und einer demokratischen Transition kommt. Ähnlich wie al-Bashir zuvor, hat Hemedti hat sicher kein Interesse daran, sich einer zivilen Regierung zu unterwerfen, sein Vorgehen zum Gegenstand von Ermittlungen zu machen und seine Miliz in die Armee zu integrieren.
Es besteht weiterhin die Gefahr, dass ein Teil der Sicherheitskräfte, insbesondere Hemedtis RSF, den friedlichen Übergang blockieren. Der Sicherheitssektor im Sudan ist schließlich kein einheitlicher Akteur: Bashir hatte die sudanesische Armee gezielt geschwächt und Sicherheitsaufgaben allmählich an eine dysfunktionale Gruppe von staatlich unterstützten Milizen und Paramilitärs ausgelagert, um einem koordinierten Putsch gegen sich auszuschließen. Es gibt acht konkurrierende Sicherheitsdienste: Das Militär, die Polizei und-Geheimdienstbehörde, sowie sechs Milizen; eine davon sind die Rapid Support Forces.
Experten wie Alex de Waal sehen in Hemedti und den RSF weiterhin die wirklichen Machthaber im Sudan, trotz der Einigung zwischen Militär und Protestbewegung: Die RSF als Hybrid aus ethnischer Miliz, Wirtschaftsunternehmen und transnationaler Söldnertruppe, scheine nun den Staat erobert zu haben. Die RSF kontrolliert seit Ende 2017 die Goldproduktion im Norden Darfurs. Als Bashir im April gestürzt wurde, sei Hemedti einer der reichsten Männer im Sudan gewesen, mit einem engen Netz an Beziehungen. Er habe daher beste Voraussetzungen, um nach der Macht zu greifen.
Laut der International Crisis Group, würden zwar inzwischen viele im sudanesischen Offizierskorps ihr Schicksal eher der Oppositionselite Khartums anvertrauen als Hemedti, den sie als räuberischen Provinzkriegsherrn betrachten und dem es nicht nur an Legitimität, sondern offenbar auch an einer politischen Unterstützerbasis fehlt, um allein zu regieren. Auch hat sich Hemedti nach Einschätzung von Journalisten vor Ort als offizieller Führer der Junta verbrannt, da er spätestens seit dem gewaltsamen Vorgehen gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten Anfang Juni international wohl kaum als akzeptabler Gesprächspartner gelten würde. Trotzdem besteht die Gefahr, dass Hemedti den Weg der Gewalt einschlägt, um seine Pfründe zu schützen.
Das instabile Umfeld der aktuellen Geschehnisse im Sudan
Der Sudan liegt schließlich nicht nur an einem zentralen geostrategischen Ort auf dem afrikanischen Kontinent: Er bildet die zentrale Brücke zwischen dem Horn von Afrika und Nordafrika sowie zwischen Nord- und Subsahara-Afrika. Sudan ist auch ein sehr fragiler Staat, in einer instabilen Region. Im benachbarten, seit 2011 unabhängigen, Südsudan schwelt weiterhin der seit 2013 andauernde Bürgerkrieg. Mit Tschad befindet sich der Sudan in einem Rivalitätsverhältnis. Im Jemen, an der Sudan gegenüberliegenden Seite des Roten Meers, herrscht Krieg, in welchem auch sudanesische Soldaten – insbesondere die Rapid Support Forces – als Söldner für Saudi-Arabien kämpfen. In der zentralafrikanischen Republik existiert allenfalls schwache Staatlichkeit. In Libyen kämpfen verschiedene Parteien um die Vorherrschaft im Land – auch dort sollen Hemedtis RSF aktiv sein.

Karte Sudan (Quelle: Open Street Maps)
Auch der Sudan ist ein instabiler Staat: Während seiner 30-jährigen Regierungszeit haben Bashir und andere Regierungsbeamte zunächst im bis zum Jahr 2005 andauernden Bürgerkrieg Kriegsverbrechen und anschließend dann Verbrechen gegen die Menschlichkeit, bis hin zum Völkermord an Zivilisten in den Regionen Süd-Kordofan, Blue Nile und Darfur begangen. Diese Konflikte sind nach einer Vermittlung durch die Afrikanische Union seit 2016 zwar ein wenig beruhigt, zu einer endgültigen Einstellung der Feindseligkeiten ist es insbesondere in Süd-Kordofan und Blue Nile jedoch nicht gekommen.
Seit 2007 ist in Darfur außerdem die gemeinsame Mission der UN und der Afrikanischen Union UNAMID in Darfur stationiert, um die Lage zu beruhigen. Die Truppen sollen in erster Linie für den Schutz von Zivilisten sorgen, was ihnen aber kaum gelingt. Im Juli 2018 hatte der Sicherheitsrat ursprünglich beschlossen, UNAMID im Juni 2020 zu beenden und das internationale Engagement in eine zivile Stabilisierungsmission umzuwandeln, während sudanesische Sicherheitskräfte die Ordnungsmacht übernehmen sollen. Menschenrechtsorganisationen und auch der stellvertretende UN-Generalsekretär für Menschenrechte, Andrew Gilmour, berichteten jedoch im Juni 2019, dass es auch in Darfur eine Zunahme der Menschenrechtsverletzungen und Angriffe auf Protestierende gegeben habe. Ende Juni 2019 beschloss der UN Sicherheitsrat daher, den Einsatz von Blauhelmen der Vereinten Nationen in der Region Darfur vorerst fortzusetzen und die Truppenstärke nicht weiter zu reduzieren.
Die Bedeutung externer Akteure
Die mächtigsten Unterstützer der derzeitigen Militär-Junta in Sudan finden sich außerhalb des Sudans – in Kairo, Riyadh und Abu Dhabi. Die Saudis und Emiratis heißen insbesondere Hemedti gut, da seine Rapid Support Forces im Jemen-Krieg als Söldner für Saudi-Arabien kämpfen. Nach dem Sturz Bashirs sagten Ägypten, Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dem Militärübergangsrat drei Milliarden Euro an Hilfe zu, um sich ihren Einfluss zu sichern. Besonders Saudi Arabien und die VAE scheinen zudem nicht allzu unglücklich über den Sturz ihres alten Verbündeten Omar al-Bashir zu sein, da dieser sich in deren Streit mit Katar im vergangenen Jahr nicht entschieden auf ihre Seite stellte. Die Golfstaaten und Ägypten vertrauen darauf, dass die Generäle den Sudan in einem geordneten Übergang zu einem, ihnen wohlgesonnenen, Regime führen. Für sie gilt es, ein unangenehmes Zwischenspiel wie in Ägypten zu vermeiden. Also Wahlen, die eine ihnen skeptisch gegenüber eingestellte Regierung hervorbringen könnten.
Und das wäre in der Tat nicht ausgeschlossen: Bei den Demonstrationen wurde schon der Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Saudi Arabien gefordert. Auch die Tatsache, dass das Durchgreifen gegen das Protestcamp in Karthum Anfang Juni kurz nach den ersten Staatsbesuchen der sudanesischen Militär-Führer am 23. Mai in Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geschah, nährte den Verdacht der Demonstrierenden, dass diese den sudanesischen Militärs signalisiert hätten, dass sie auch den Weg der Gewalt statt den des Kompromisses mittragen würden.
Laut der International Crisis Group gibt es aber inzwischen Anzeichen dafür, dass Saudi Arabien und die anderen Unterstützer aus dem Golf ihre Position angesichts der internationalen Verurteilung der Angriffe auf unbewaffnete Demonstranten abgeschwächt haben. Am 5. Juni äußerte Saudi-Arabien öffentlich „große Besorgnis“ über den Verlust von Menschenleben im Sudan und forderte eine Wiederaufnahme des Dialogs. Dieser Kritik durch Saudi Arabien scheint auch auf Druck der USA zurückzuführen sein, die drauf drängen, dem Willen der Protestierenden zu folgen und einen Übergang zu einer zivil geführten Regierung einzuleiten. Saudi Arabien scheint aber offensichtlich auch zu versuchen, es sich mit einer möglichen zivilen Regierung nicht vollkommen zu verscherzen.
Zweifelsohne haben diese Staaten den größten Einfluss auf das ansonsten international und auch in Afrika – die Afrikanische Union hat die Mitgliedschaft Sudans in der Regionalorganisation nach dem Massaker Anfang Juni ausgesetzt – weitgehend isolierte Militär in Sudan.
Doch auch die Europäische Union hat einen gewissen Einfluss und auch eine Verantwortung durch ihre Kontakte zu den sudanesischen Sicherheitskräften: Die EU arbeitet mit Sudan im Rahmen des sogenannten Khartum-Prozesses zusammen. Der Khartum-Prozess ist eine Dialogplattform zwischen der EU und den Ländern am Horn von Afrika. Sie existiert seit 2014 und wurde beim EU-Gipfel in Malta 2015 mit dem Migrationsmanagement in der Region beauftragt. Der Khartum-Prozess umfasst eine Vielzahl von Initiativen. Alle sollen die Zahl der Menschen, die das Mittelmeer überqueren, reduzieren. Im Rahmen der Koordinierung dieser Maßnahmen arbeiten europäische Sicherheitsbehörden mit sudanesischen Sicherheitskräften in Khartum zusammen und damit – zumindest indirekt – auch mit den Rapid Support Forces Hemedtis, denn die RSF sind auch in die Grenzsicherung in Sudan eingebunden.
Was kann nun getan werden?
Die Afrikanische Union, die EU und andere Staaten müssen ihren Druck aufrechterhalten, damit die Militärs in Sudan nicht wieder zu ihrem Plan zurückkehren, innerhalb relativ kurzer Zeit Wahlen abzuhalten. Es braucht eine Übergangsphase, um die notwendigen Strukturen für faire Wahlen zu schaffen. Die AU, die USA und die EU sollten den Mitglieder der sudanesischen Sicherheitskräfte, die einem politischen Abkommen im Wege stehen oder gar mit Gewalt drohen, weiterhin deutlich machen, dass sie mit gezielten Sanktionen, Einfrieren von Vermögenswerten und Reiseverboten belegt werden könnten. Dies gilt insbesondere für Hemedti. Im Falle eines Abbruchs des Übergangsprozesses oder neuer Gewalttaten sollte diese Sanktionen schnell umgesetzt werden.
Die EU und die USA sollten weiterhin bekräftigen, dass keine Gespräche mit Khartum über die Normalisierung der Beziehungen möglich sind, solange es keinen stabilen, friedlichen und für die Protestbewegung akzeptablen Übergang gibt, der auf eine zivile Führung hinausläuft. Dies könnte dann die Aufhebung von Sanktionen, seitens der USA die offizielle Aufhebung des Labels „staatlicher Sponsor des Terrorismus“, oder auch einen Schuldenerlass bedeuten. Die Zusammenarbeit mit sudanesischen Behörden im Migrationsmanagement sollte erst dann wieder aufgenommen werden, wenn zuverlässige und überprüfbare Garantien im Bereich Menschenrechtsschutz vorliegen.
Akteure mit Einfluss auf Kairo, Riad und Abu Dhabi, insbesondere die USA, aber auch die EU und Deutschland, sollten die Golfstaaten und Ägypten auffordern, Druck auf die Generäle in Khartum auszuüben. Sie sollten die sudanesische Junta drängen, sich an die geschlossene Übereinkunft zu halten und eine zivil geführte Übergangsregierung zu stützen, die die Stabilität wiederherstellen kann. Gerade Ägypten, ein wichtiger regionaler Akteur und derzeit auch Vorsitzender der AU, sollte jedes Interesse daran haben, ein Chaos wie in Libyen in einem weiteren Nachbarstaat zu vermeiden.
Saudi-Arabien und die VAE sollten außerdem Hemedti und die RSF versuchen zu zügeln und sie auffordern, sich zurückzuziehen, um den Abstieg ins Chaos zu verhindern. Stattdessen sollte denen Raum gegeben werden, die in der Lage sind, einen friedlichen Übergang zu gestalten und ein Abgleiten in einen Bürgerkrieg zu verhindern.
Nach dem nun verschobenen Abzug von UNAMID und den jüngsten Entwicklungen im Land muss der UN-Sicherheitsrat die prekäre Sicherheitslage in Darfur weiterhin genau beobachten. Mit Blick auf die Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft gilt dies insbesondere im Hinblick auf die Gefahr weiterer Massaker und schwerster Menschenrechtsverletzungen. Es sollte außerdem deutlich gemacht werden, dass der Sicherheitsrat und die internationale Gemeinschaft vom Übergangsmilitärrat und der nun hoffentlich folgenden Übergangsregierung erwarten, dass die für die Gewalt Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und Omar al-Bashir und andere Mitglieder des alten Regimes, die vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden, endlich nach Den Haag ausgeliefert werden.
Autor: Gregor Hofmann, Vorsitzender Genocide Alert
Dieser Text ist eine aktualisierte Fassung eines Vortrags des Autors zur Lage in Sudan bei der Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft Frieden von Bündnis 90/Die Grünen RLP am 6. Juli 2019 in Mainz.
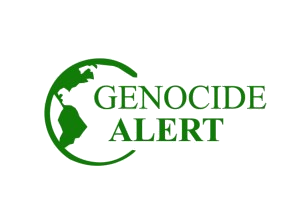

 Justitia, Quelle: AJEL/Pixabay Free for commercial use/No attribution required-License
Justitia, Quelle: AJEL/Pixabay Free for commercial use/No attribution required-License

 Workshop der Abteilung für Zivilangelegenheiten der UN-Operation in Côte d'Ivoire mit lokalen Führern in Bonoua 2012 (Quelle: UN PHOTO | # 511356)
Workshop der Abteilung für Zivilangelegenheiten der UN-Operation in Côte d'Ivoire mit lokalen Führern in Bonoua 2012 (Quelle: UN PHOTO | # 511356) 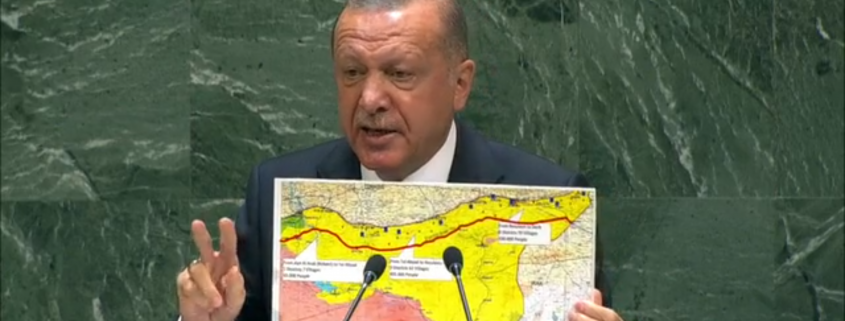 UNGA Web TV
UNGA Web TV Protestierende in der Nähe des Armeehauptquartiers in Khartum am 8. April 2019 (Quelle: M.Saleh | Wikimedia Commons)
Protestierende in der Nähe des Armeehauptquartiers in Khartum am 8. April 2019 (Quelle: M.Saleh | Wikimedia Commons)
![Courtyard of Genocide Memorial Church-Karongi-Kibuye, Western Rwanda (By Adam Jones, Ph.D. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)](https://www.genocide-alert.de/wp-content/uploads/2016/11/Never_Again_Courtyard_of_Genocide_Memorial_Church_Karongi-Kibuye_-_Western_Rwanda_768x333-768x321.jpg) Courtyard of Genocide Memorial Church-Karongi-Kibuye, Western Rwanda (By Adam Jones, Ph.D. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)
Courtyard of Genocide Memorial Church-Karongi-Kibuye, Western Rwanda (By Adam Jones, Ph.D. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons) Genocide Alert hat 2014 im Rahmen des
Genocide Alert hat 2014 im Rahmen des  Als Teil des Projektes erstellte Genocide Alert e.V. zudem einen Twitter-Account namens
Als Teil des Projektes erstellte Genocide Alert e.V. zudem einen Twitter-Account namens 
 UN Office on the Prevention of Genocide and the Responsibility to Protect
UN Office on the Prevention of Genocide and the Responsibility to Protect