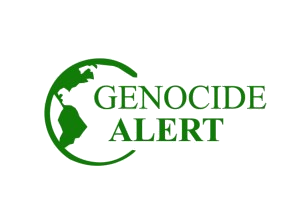Die UN im Süd-Sudan: Schutz der Bevölkerung muss Priorität werden
Will man die Konflikte im Südsudan verstehen, muss man auch über die Rolle der Vereinten Nationen in dieser Region im Bilde sein. Mit der „United Nations Mission in Sudan“ – kurz UNMIS – verfügen diese mit einer Personalstärke von 10.000 Soldaten, Polizisten und zivilen Mitarbeitern über eine nicht zu unterschätzende Präsenz auf dem Gebiet des Südsudans und in den Übergangsregionen. Die anhaltende Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung im Südsudan zeigt jedoch, dass UNMIS nur unzureichend in der Lage ist diese zu schützen. Angesicht des drohenden Gewaltausbruchs im Zusammenhang mit dem Referendum im Januar 2011 gilt es die Mission umgehend zu stärken. Andernfalls wären die Vereinten Nation wiedereinmal dazu verdammt, inmitten tausendfachen Mordens dem Leiden hilflos zusehen zu müssen.
Die mit der Sicherheitsratsresolution 1590 am 24. März 2005 ins Leben gerufen UNMIS soll vor allem die Einhaltung und Umsetzung des „Comprehensive Peace Agreements“ gewährleisten. Sie ist dementsprechend als eine traditionelle Peacekeeping-Mission nach Kapitel VI der UN-Charta angelegt und leicht bewaffnet. Darüber hinaus enthält ihr Mandat jedoch auch Kapitel VII Elemente. Mit anderen Worten: Der Einsatz von Zwangsmaßnahmen – bis hin zum Gebrauch von Schusswaffen – zum Schutz der Zivilbevölkerung ist eindeutig zulässig. So gesehen ist UNMIS mit einer größeren Handlungsfreiheit ausgestattet, als dies in früheren UN-Mission, der Fall war.
An dieser Stelle setzt jedoch auch bereits die Kritik an der Ausführung der Mission ein. Obwohl das Mandat durchaus den Schutz von Zivilisten als Aufgabe vorsieht, lag der Fokus von Anfang an auf der Beobachtung des Friedensabkommens. Dementsprechend wurde die Schutzkomponente bei der Planung nur unzureichend berücksichtigt. Dies schlug sich nicht zuletzt in der personellen Zusammensetzung nieder. Offensichtlich hat sich die UNMIS-Führung kaum Gedanken darüber gemacht, wie sie die Schutzkomponente ihres Mandates überhaupt erfüllen könnte. Konkrete Strategien und Konzepte zu deren Umsetzung blieben aus.
Diese Mängel traten auf blutige Weise zu Tage. Dass im März und April bei interethnischen Überfällen in der Provinz Jonglei mehr als 1000 Männer, Frauen und Kinder ums Leben kamen, zeigte mehr als deutlich, dass UNMIS trotz seines weitgehenden Mandates nicht in der Lage war, derartige Massenverbrechen zu verhindern. Die Massaker blieben auch nicht auf Jonglei begrenzt. Auch den Tod von 72 Zivilisten im „Upper Nile State“, nur wenige Wochen später, konnte UNMIS nicht verhindern. Bereits vorher war UNMIS nicht in der Lage Attacken, wie beispielsweise von der „Lord Resistace Army“ aus Uganda, zu unterbinden.
Da es immer deutlicher wurde, dass die Regierung des Süd-Sudan ebenso wenig in der Lage ist ihre Schutzverantwortung gegenüber ihrer Bevölkerung wahrzunehmen, ist es notwendig, dass UNMIS der Schutz von Zivilisten endlich höchste Priorität einräumt und nicht nur auf die Beobachtung des Waffenstillstandes beschränkt. Obwohl die UNMIS-Führung bereits im Vorfeld der oben genannten Massaker Kenntnisse über die akuten Spannungen in der Region hatte, versäumte sie es ihre Präsenz zu erhöhen und konfliktentschärfende Maßnahmen zu ergreifen. Stattdessen müssen die Kommandeure von UNMIS ein proaktives Verhalten an den Tag legen und ihr Mandat voll ausfüllen. Dass sie es bisher nicht tut, ist der UNMIS-Führung selbst bewusst. 2008 gab ein UNMIS-Kommandeur in einem Report zu: „Jeglicher Schutz von Zivilisten, den wir bieten könnten, wäre zufällig“. Dafür sei vor allem das zu geringe Truppenkontingent verantwortlich.
Es gibt jedoch Anzeichen, dass UNMIS zum Teil aus ihrem Versagen gelernt hat und dabei ist, dem Schutz von Zivilisten eine höhere Priorität einzuräumen und ihre Truppenstärke in besonders gefährdeten Gebieten zu erhöhen. Unzureichendes Personal, der Umstand, dass es der UN generell an einem Konzept für den Schutz von Zivilisten mangelt und die traurige Erfahrung, dass UN-Kommandeure im Zweifelsfall die Sicherheit der eigenen Soldaten gegenüber der der Zivilbevölkerung Vorrang einräumen, stimmt jedoch nicht gerade hoffnungsvoll, dass weitere Gewalt verhindert werden kann.
Tatsache ist, dass UNMIS nicht einmal in der Lage ist den Schutz von Zivilisten zu gewährleisten, solange offiziell Frieden herrscht. Dies führt einem vor Augen, welches Ausmaß an Gewalt und welch horrende Opferzahlen zu erwarten sind, wenn es im Zuge des Referendums zu einem erneuten offenen Krieg in der Region kommen würde. Schließlich war auch in Ruanda eine UN-Mission zur Überwachung eines Friedensabkommen vor Ort. Als das Abkommen zerbrach und der Völkermord begann, konnte diese schließlich nur noch zusehen.
In der für den Sudan kritischen Phase des Referendums ist es deshalb notwendig, die Kapazitäten von UNMIS entsprechend anzupassen. Vor allem die Fähigkeit auf aufflammende Gewalt rechtzeitig zu reagieren muss weiter ausgebaut werden. Selbstverständlich muss eine Lösung des Konflikts auf der politischen Ebene erfolgen und die Wurzeln der Gewalt müssen in einem umfassendem Ansatz angegangen werden. Dennoch ist auch hierfür Stabilität und die Sicherheit der Bevölkerung die Grundvorraussetzung.
Die Bundesregierung muss sich hier ihrer Verantwortung stellen, den deutschen Truppenanteil aufstocken, um den Konfliktparteien deutlich zu machen, dass ihr das Schicksal der Zivilbevölkerung nicht egal ist. Bereits jetzt könnte sich die Bundeswehr auf die Bereitstellung eines Kontingents vorbereiten. Im Fall der Fälle würde dann weniger wertvolle Zeit verloren gehen und tausende Menschen könnten gerettet werden.
Damit würde die Bundesregierung nicht nur entsprechend der auf dem UN-Weltgipfel 2005 beschlossenen Schutzverantwortung handeln, sondern auch das in dem fraktionsübergreifenden Antrag am 24. März 2010 im Bundestag gegebene Versprechen halten, „sich innerhalb der UN dafür einzusetzen, dass UNMIS gemäß dem Mandat mit dem erforderlichen Personal (Militär- und Polizeikräfte) und Material ausgestattet wird.“
Von Christoph Schlimpert